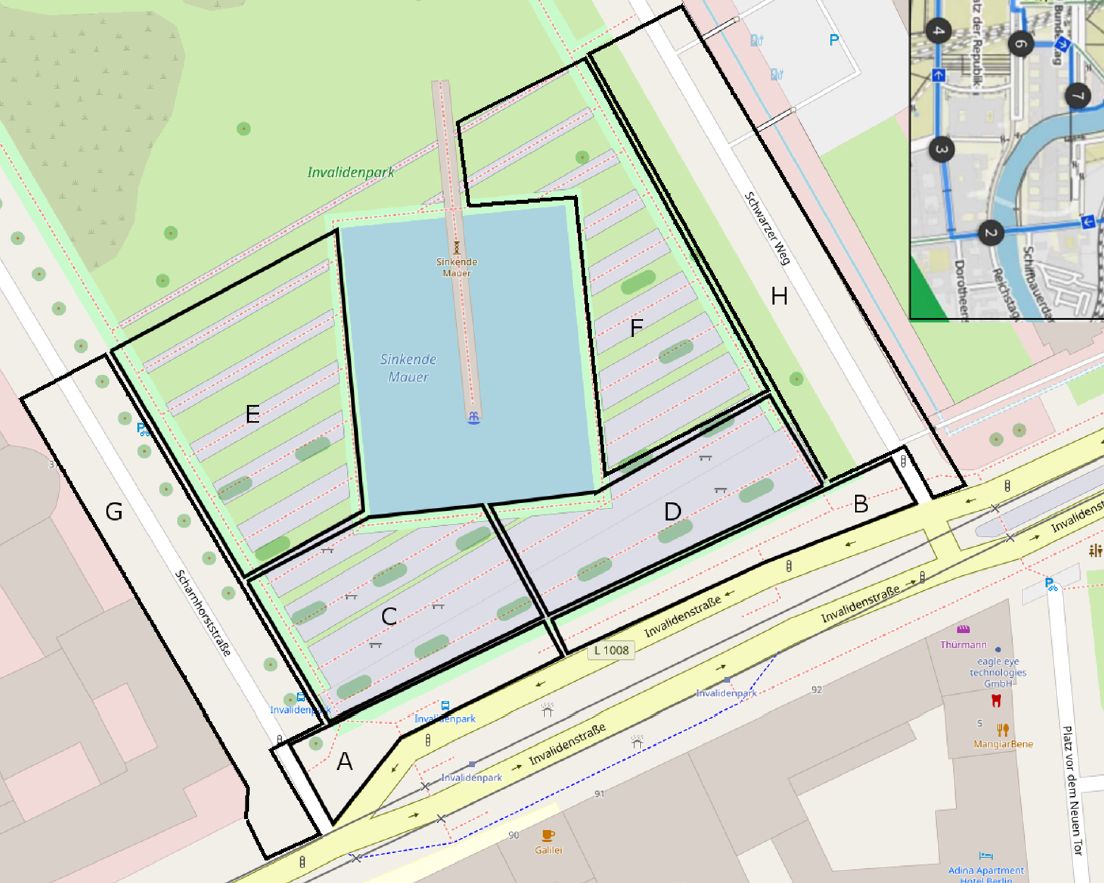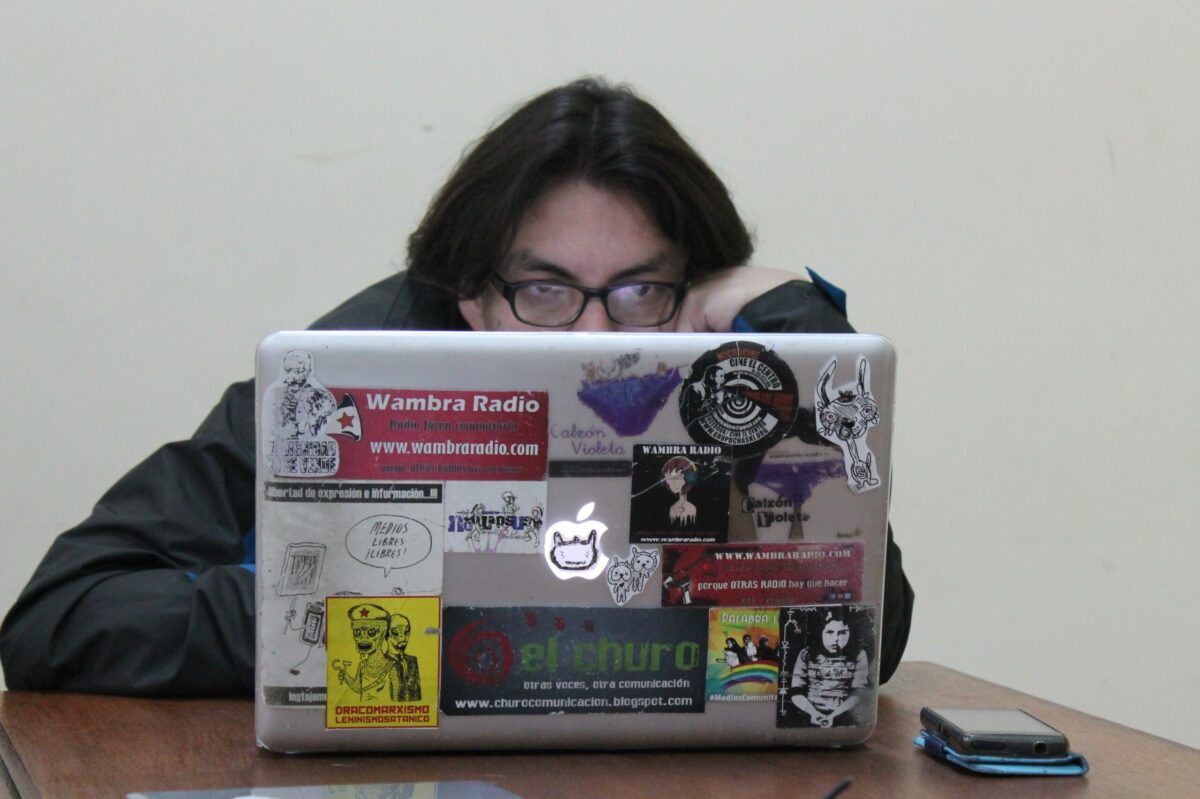Seit 2018 schreiben Autor*innen des ipb in einer eigenen Rubrik des Forschungsjournals Soziale Bewegungen: “ipb beobachtet”. Die Rubrik schafft einen Ort für pointierte aktuelle Beobachtungen und Beiträge zu laufenden Forschungsdebatten und gibt dabei Einblick in die vielfältige Forschung unter dem Dach des ipb.
Zu den bisher erschienenen Beiträge, die alle auch auf unserem Blog zu lesen sind, geht es hier.
Der folgende Text von Leslie Gauditz erschien unter dem Titel „Sind manche Gruppen schwerer zugänglich als andere? Erfahrungen und Reflektionen zu Coronaprotesten und Fluchtaktivismus“ im Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 36, Heft 1.
Um in der Protestforschung viele und qualitativ hochwertige Daten zu erheben braucht man häufig Zugang zu den Aktivist:innen. Denn um ein Interview zu führen, einen Fragebogen ausgefüllt zu bekommen oder Einblicke in alltägliche oder organisatorische Abläufe einer Bewegung zu gewinnen, müssen die Aktivist:innen einwilligen. Das tun sie nicht immer, weshalb der Zugang zum Forschungsfeld, ein vieldiskutiertes Thema ist (vgl. z. B. Gauditz 2019). Gerade im Zusammenhang mit interaktionsnahen Methoden bei denen Forschende und Forschungsteilnehmende direkt interagieren, muss geklärt werden, wovon es abhängt, dass aktivistische Personen oder Gruppen, die jemand im Rahmen wissenschaftlicher Protestforschung beforschen möchte, zugänglich sind oder nicht.
Doch gibt es keine one-fits-all Lösung dafür den Zugang und eine Forschungseinwilligung zu erhalten, sondern es ist von mehreren Faktoren abhängig, beispielweise davon wieviel Vertrauen den Forschenden oder der Wissenschaft im Allgemeinen geschenkt wird, oder davon was sich die Beforschten vom Ergebnis erwarten. Als 2020 die ersten Corona-maßnahmenkritischen Proteste auftraten war zwar schnell klar, dass die Teilnehmenden heterogen zusammengesetzt waren, aber wissenschaftliche und journalistische Untersuchungen konnten auch Traditionslinien und inhaltliche Nähe zu rechten und verschwörungstheoretischen Protesten wie z. B. den Montagsmahnwachen, der Reichsbürgerszene oder rechtsoffenen Esoterikkreisen identifizieren (Teune 2021; Ginsburg 2021; Schließler/Hellweg/Decker 2020; Nachtwey/Schäfer/Frei 2020). Aufgrund dieser Kontinuitäten und der zudem weit verbreiteten wissenschaftskritischen Einstellung bei den Maßnahmenkritiker:innen diagnostizierten viele Bewegungsforschenden, den Corona-Maßnahmen-Kritiker:innen, sie seien eine Gruppe, zu der man nur schwer Zugang fände. Stimmte das?
Bei Kolleg:innen, welchen ich erzählte, dass ich Interviews mit einigen Personen aus der maßnahmenkritischen Szene geführt hatte, war jedenfalls die Überraschung groß. Man ging davon aus, dass die nichts mit Uni zu tun haben wollen, oder dass ich verheimlicht haben müsse, dass ich gegen Covid-19 geimpft war. Doch meine Erfahrung war eine andere: Die befragten Personen waren ganz erpicht darauf mit mir zu sprechen und empfahlen mir im Nachhinein Gesprächspartner:innen weiter. Eine Person meldete sich selbstständig, weil sie von dem Projekt über einen Journalisten erfahren hatte. Alle fanden zeitnah Zeit für ein Gespräch.
So eine Bereitwilligkeit ist mir in meinem Forscherinnen-Leben noch nie begegnet. In den Jahren zuvor habe ich zu Flüchtlingsaktivist:innen geforscht. Interviews in den sprichwörtlichen „Kasten“ zu bekommen, war ein aufwändiger und langwieriger Prozess gewesen, in dem ich immer wieder beweisen musste, dass ich der Bewegung etwas Produktives zurückgeben wollte. Damals war mein Umfeld nicht ansatzweise vergleichbar überrascht darüber gewesen, dass es geklappt hatte. Mein Eindruck ist, dass sich aus der gemeinsamen Diskussion dieser beiden Erfahrungen etwas lernen lässt.
Die These die diesem Text zugrunde liegt ist die, dass die Einschätzung darüber, welche Gruppe schwer zugänglich seien, mehr über die Kategorisierung von Forschenden aussagt, als über den Gegenstand, bzw. als darüber wie die im Zentrum des Erkenntnissinteresses stehenden Personengruppen aus sozialwissenschaftlicher Sicht zusammengesetzt sind. Eine Reflektion darüber entlang des Gegenstands „Soziale Bewegungen“ ist für die Protestforschung sinnvoll, da sich die politische Landschaft derzeit durch das Erstarken rechter und anderer demokratiefeindlicher Bewegungen verändert
1 Wen beforscht die Bewegungsforschung?
Fragen wir uns in der Protest- und Bewegungsforschung, wie sie die Aktivist:innen und Bewegungen kategorisiert, mit denen sie sich beschäftigt, so müssen wir realistischerweise anerkennen, dass es in der westlichen Forschungsgemeinde, die sich beispielsweise im Netzwerk des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb e.V.) befindet, eine Tendenz dazu gibt, jene sozialen Bewegungen zu untersuchen, welche im progressiven oder „linken“ Spektrum angesiedelt sind (siehe dazu Gotto/Mecking 2021 oder die Diskussion in Diefenbach et al. 2019). Das Untersuchungsfeld umfasst dabei klassischerweise ein breites Feld von Arbeiter:innenkämpfen, über die Friedens-, und Anti-AKW-, Umwelt- und Klima-Bewegung, bis zu Feminismen, LGBTQI und Antifaschismus und -rassismus. Das scheint auch an einer persönlichen Neigung der Forschenden zu liegen, jene Bewegungen zu untersuchen, zu denen eine persönliche politische Affinität besteht. Methodisch hat dies den Vorteil, dass häufig eine ideelle oder auch persönliche Nähe zum beforschten Protestphänomen fruchtbar gemacht werden kann, weil man vielleicht schon Kontakt zu ersten Interviewpartner:innen hat oder durch inhaltliche und habituelle Nähe vertrauenswürdig auftreten kann.
Durch solch eine auf Sympathie beruhende Arbeit mit Bewegungen etablierten sich in der Forschungsgemeinde implizite und explizite Kriterien zur Beurteilung „guter“ Protestforschung, die entlang von ethischen Kriterien laufen und die maßgeblich partizipativen Forschungsmethoden entstammen: Forschende sollen a) mit Aktivist:innen zusammen oder im Dialog mit ihnen forschen, und b) soll Wissen produziert werden, welches der Bewegung hilft, oder dieser zumindest nicht unnötig schadet. In den Schulen von activist scholarship, engageed scholarship oder militant research spiegelt sich diese Tradition besonders deutlich wider. Ein anderes Beispiel bietet Interface, eine frei zugängliche Fachzeitschrift „for and about social movements”, welche den Anspruch hat, Wissen zu produzieren, das Bewegungsakteur:innen zugänglich ist (Interface 2023). Und auch das Forschungsjournal Soziale Bewegungen, in dem dieser Beitrag erscheint, möchte „Wissenschaft und Politik in den Dialog“ rund um Demokratisierung bringen (Forschungsjournal Soziale Bewegungen ohne Datum).
Das sind Stärken der Bewegungsforschung, die aber zu einer unproduktiven Engführung der Subdisziplin geraten können, sobald man sich mit Aktivismus befasst, zu dem keine politische Nähe besteht – allen voran rechte Bewegungen oder radikaler Islamismus. In jenen Fällen greift das erprobte Handwerkszeug nicht. Denn, wenn ich eine Gruppe beforsche, von der ich möchte, dass sie nicht erfolgreich ist oder dass sie sich gar auflöst, dann ist mir als forschende Person der sensible Feldzugang im Zweifel egal. Schließlich möchte man in Zukunft vermutlich eh nicht mehr mit der Gruppe zusammenarbeiten. Es kann bisweilen sogar explizites Ziel der Forschung sein, dem politischen Projekt der Aktivist:innen zu schaden, indem Wissen über ihre Taktiken und Ziele veröffentlicht wird.
Eine Diskussion über diese Problematik fand bereits Eingang in dieser Rubrik des FJSB (vgl. Diefenbach et al. 2019), und war mehrfach Thema auf der 2022er Jahrestagung des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb). In Panels wie auf Plenarveranstaltungen wurden oben genannte methodische und ethische Ratschläge der Bewegungsforschung als nicht hilfreich abgelehnt und festgestellt, dass sie nicht auf alle globalen Kontexte übertragbar seien. Dort wurde debattiert, dass sich die Bewegungsforschung angesichts der zunehmenden Stärke rechter oder rechtpopulistischer Kräfte mit deren Inhalten und Dynamiken auseinandersetzen müsse und entsprechende Analysen nicht der Extremismusforschung überlassen werden sollten, da diese andere und häufig unkritischere Schwerpunkte als die Bewegungsforschung setzt. Dem lässt sich hinzufügen, dass es gerade für eine kritischen Perspektive auf „Extremismus“ wichtig scheint, eine eigene protestforschenden Herangehensweise zu entwickeln, da immer wieder Interessensüberschneidungen mit staatlichen Institutionen entstehen, die Forschung gegen beispielsweise rechte Bewegungen finanzieren, und somit eher die Gefahr besteht, staatliche Kategorisierungen (z. B. versicherheitlichende Logiken) zu übernehmen (Teune/Ullrich 2018).
Das sind nun also allgemeine Dynamiken der Bewegungsforschung. Mein Eindruck ist, sie spiegelten sich in den letzten Jahren in der Art und Weise wider, wie seit Beginn der Pandemie die sog. „Querdenker“ erforscht wurden und lassen sich deswegen gut an diesem Beispiel diskutieren.1
2 Die Corona-Proteste und ihre Einordnung als gefährliches Phänomen
Als im Frühjahr 2020 die Covid-19-Pandemie Deutschland und Europa erreichte, ahnte wohl kaum jemand welche weitreichenden Veränderungen in der politischen Debatte mit ihr einher gehen würden. Sie entzündeten sich unter anderem daran, dass auf Protesten gegen die Eindämmungsmaßnahmen (Lockdowns, Maskentragen etc.) vielfach verschwörungstheoretisch informierte Verharmlosung oder Leugnung des Virus formuliert wurde. Außerdem verbanden viele Teilnehmende ihre Ablehnung der Coronamaßnahmen mit einer allgemeinen Kritik an der Regierung oder dem realdemokratischen Staatswesen. Vielleicht deswegen ordneten etablierte Medien und Regierungspolitiker:innen diese Kritik als weitgehend illegitim, unsolidarisch oder irrational ein. Der Verfassungsschutz führte gar anlässlich der Proteste die neue Kategorie „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ ein (Bundesamt für Verfassungsschutz 2023).
Eine Analyse englischsprachiger Nachrichten zeigte, dass diese die Protestierenden zu großen Anteilen negativ oder gar dämonisierend darstellten (Jaspal/Nerlich 2022). Mein Eindruck ist, dass sich diese Ergebnisse für deutsche Medien reproduzieren ließen,2 und sich auch zu einem gewissen Grad in der akademischen und publizistischen Analyse der ersten zwei Jahre der Pandemie abzeichnen. Einige Studien zeigten zwar die heterogene und uneindeutige politische Zusammensetzungen der Teilnehmenden (Frei/Nachtwey 2022; Hanloser 2021; Grande et al. 2021). Aber insgesamt avancierte „Querdenken“, der Name einer für die Mobilisierungen wichtigen Initiative des Bewegungsspektrums, zum Synonym für eine „Protestbewegung zwischen Demokratieverachtung, Hass und Aufruhr“ (Benz 2022), welche „gefährliche Weltbilder“ verbreitete (Speit 2021). Das erscheint mir deswegen bemerkenswert, da sich hier ein ungewöhnlicher Einklang kritischer Wissenschaft mit Staat oder Verfassungsschutz zeigt.
Tatsächlich können Studien zeigen, dass rechte und rechtspopulistische Akteur:innen die Pandemie erfolgreich nutzten, um ihre Inhalte bei der breiteren Bevölkerung zu setzen und zu normalisieren (Müller 2022; Salheiser/Richter 2020). Auch wenn es bei solchen Erfolgen regionale Unterschiede gab: Die rechtsextremen „Freien Sachsen“ konnten sich über Coronaproteste etablieren, während in Baden-Württemberg Grün-Wähler:innen und Antroposoph:innen eine politisch eher gemäßigte Basis lieferten, auf die sich verschwörungstheoretische Narrative aufsetzten. Ich könnte noch mehr Zeit damit zubringen dies einzuordnen,3 wichtig ist es mir an dieser Stelle aber, zu zeigen, dass sich die fachliche Debatte bis 2022 maßgeblich an der Frage entlang hangelte, wie demokratiegefährdend oder gefährlich hinsichtlich des Pandemiegeschehens, dieses Protestphänomen sei. Ich schließe daraus, dass die (erweiterte) Forschungsgemeinschaft der Protestforschung keine politische Nähe zum Gegenstand empfand.
Methodisch spiegelte sich diese Einschätzung der Querdenker als gefährliche und politisch von Forschenden entfernte Subjekte darin wider, dass meist interaktionsferne Methoden gewählt wurden, allen voran verdeckte Beobachtungen von Protesten und sozialen Medien, bei denen das Phänomen sozusagen indirekt sondiert wurde (u. a. Hanloser 2021; Frei et al. 2021; Hentschel 2021). Interviewbefragungen wurden zwar auch durchgeführt (Frei/Nachtwey 2022; Pantenburg/Reichardt/Sepp 2021), bilden aber die Ausnahme. Einige Debattenbeiträge zu den Corona-Protesten bezogen sich nur noch metaanalytisch auf diese empirischen Erhebungen oder journalistische Analysen (z. B. Teune 2021; Opheys/Bremer 2022). Ethische Diskussionen dazu, wie mit den Befragten umzugehen sei, also beispielsweise dazu, ob man die Aktivisten vor dem Zugriff des Staates oder Polizei schützen müsse, sind mir keine bekannt. Das fiel mir deshalb auf, weil ich das ganz anders kannte: aus der Forschung zu Flucht und Migration.
3 Erfahrungswerte: Anspruchsvoll zugänglicher Fluchtaktivismus und redebegierige Maßnahmenkritiker:innen
Die Corona-Proteste waren ein zentrales Thema der öffentlichen Debatte der Jahre 2020–22. Ein paar Jahre zuvor war ich in der Forschung zu meiner Doktorarbeit ähnlich nah am gesamtgesellschaftlichen Puls der Zeit: Nach dem sogenannten „langen Sommer der Migration“ des Jahres 2015 und der Flüchtlingskrise der nachfolgenden Jahre drehte sich die öffentliche Debatte gefühlt nur noch um Zuwanderung, Schutzsuchende und die Art, wie sie – je nach Medium – entweder willkommen geheißen oder weggeschafft werden konnten. Dieses öffentliche Interesse zog auch eine Vielzahl an Studien, die Neubildung von Forschungsnetzwerken und Fördertöpfen nach sich (für eine Darstellung siehe Braun et al. 2018).
Rund um Flucht werden in der Regel ethische Maßstäbe ausführlich diskutiert, die in Überschneidung mit ethischen Diskussionen aus der klinischen Forschung und der do-no-harm Maxime humanitärer Arbeit entwickelt wurden (Deps et al. 2022). Das bedeutet, dass Geflüchtete aufgrund ihrer prekarisierten Lebenssituation grundsätzlich als forschungsethisch sensibel zu handhabende, vulnerable Forschungsteilnehmende eingeordnet werden und bei der Entwicklung von Forschungsdesigns und ihrer Durchführung „Schadensminimierung als Leitprinzip“ (Krause 2016) dienen sollte. Die meisten Forschenden orientieren sich am Gütekriterium partizipativer Forschung, dass generell Wissen produziert werden soll, welches Geflüchteten nützt.
Die Forschung aus den Netzwerken der Protestforschung grenzte sich dabei deutlich ab von einer rechtskonservativen Lesart von Geflüchteten als Gefahr für den Zusammenhalt des Landes und seiner Demokratie. Häufig genutzte Forschungsgegenstände waren Proteste gegen Abschiebungen und andere Solidaritätsbewegungen (della Porta 2018; Rosenberger/Stern/Merhaut 2018). Dies zeigt zwar die gefühlte Nähe zum Forschungsgegenstand, es zeigt aber auch, dass die Gestaltung des Zugangs voraussetzungsreich ist, da ein sensibles und durchdachtes Vorgehen von der wissenschaftlichen Gemeinde eingefordert und geprüft wurde.
Im Fluchtaktivismus wurden nun solche ethischen Maßstäbe auch von den Forschungsteilnehmenden selbst eingefordert. Hier mischte sich, meiner Erfahrung nach, die kritischen Einstellungen gegenüber öffentlichen Institutionen seitens aktivistischer Geflüchteter, die ja das staatliche Migrationsregime kritisierten, und die ihrer linken Supporter:innen. Beide Gruppen zusammen überwachten schützend, welche Forschungsvorhaben umgesetzt würden. Wie in vielen Bewegungen üblich, wurden Forschende etwa daraufhin getestet, ob sie „Allys“ sind, oder es wurde herumgefragt, ob jemand ihren Ruf kannte, bevor sie Zugang erhielten. Empfehlungen waren wichtig und es herrschte eine gewisse Paranoia. In meiner Forschung, in der ich Personen mit und ohne Fluchterfahrung interviewte, mussten deswegen nicht nur Sprachbarrieren und kulturelle Missverständnisse überwunden werden, sondern auch mehrfach Plenumsentscheidungen der entsprechenden Gruppen initiiert und abgewartet werden, ob ich Zugang zu Personen oder Räumen erhalten konnte – selbst, wenn eine bestimmte Einzelperson dazu bereit gewesen war (nicht immer wurde dies positiv beschieden). Die Gesprächsverläufe waren dann ganz unterschiedlich und geprägt von dem Beziehungsaufbau, den ich zuvor hatte leisten müssen. In den meisten Fällen traten mir dann die geflüchteten Gesprächspartner:innen jedenfalls nicht als vulnerable Opfer entgegen, sondern selbstbestimmt und wohl wissend, wie sie den Forschungsprozess gestalten wollten.
Nach diesen Erfahrungen und auch der Einschätzung, dass es sicherlich schwierig wäre die Coronamaßnahmenkritiker:innen überhaupt zu kontaktieren war ich überrascht davon, dass es nach einem kurzen Anlauf kein Problem darstellte, Teilnehmer:innen von Coronaprotesten zu rekrutieren. Ich kontaktierte Interviewpartner:innen einzeln, zunächst über persönlich hergestellte Kontakte aus dem erweiterten Bekanntenkreis und dann in einem erweiterten Schneeballverfahren (es gab persönliche Empfehlung weiterer Interviewpartner:innen und es wurde in bestimmten kleineren Gruppen gepostet, dass ich suchte). Hier waren es eher außenstehende gate-keeper, also Personen, die nicht aus den Coronaprotesten kamen, aber Protestierende kannten, die davor zurückscheuten, ihre Kontakte anzufragen, die Themen Impfung und Coronaproteste also anzusprechen und weiter zu leiten. Von den Protestierenden selbst wurde ich in Vorgesprächen kurz geprüft, ob ich wohlwollend war, aber ich musste in keine organisierte Prüfung in Plena, wenn ich eigentlich Einzelpersonen angesprochen hatte, wie ich es im Fluchtaktivismus erlebt hatte. Dieser Unterschied liegt zum Teil im Samplingverfahren begründet, verriet mir aber auch bereits etwas über das Phänomen: Die Coronamaßnahmenproteste hatten weniger kollektive, etablierte Strukturen, und wenige zentrale Personen oder gewachsene geteilte Normen bezüglich Forschungsanfragen.
Das Auffälligste an den Gesprächen mit den Maßnahmengegner:innen war, dass sie alle von Dringlichkeit und dem Wunsch „mal reden zu können“, geprägt waren. Mehrere Personen bedankten sich im Anschluss bei mir für die Möglichkeit, sich mal ohne Unterbrechungen zu den Themen geäußert haben zu können. Die meisten erhofften sicherlich, dass ich als Wissenschaftlerin zur Multiplikatorin ihrer Position werden würde, doch es blieb immer auch eine persönliche Erleichterung. Eine Person bezeichnete es sogar als therapeutisch.
Was bedingt diese unterschiedlichen Erfahrungen? Meine Einschätzung dazu ist folgende: Es spiegelt die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen des Aktivismus wider. Die Coronaprotestteilnehmenden fühlten sich von den etablierten Medien und dem öffentlichen Diskurs stigmatisiert und in ihrer Redefreiheit eingeschränkt. Nicht ganz zu Unrecht hatten sie den Eindruck, dass viel über sie und nicht mit ihnen geredet wurde. Sie hatten also keine Plattform und wollten sich äußern.
Geflüchtete und andere migrantische Selbstorganisation waren nach 2015 dagegen beinahe überbeforscht. Gleichzeitig erlebten die Aktivist:innen, dass ihnen diese Aufmerksamkeit keine konkrete Verbesserung ihrer politischen oder sozialen Umstände lieferte. Häufiger hieß es, man könne nicht alle anfallenden Interviewanfragen beantworten, da sonst die Zeit für die wirkliche Arbeit fehlen würde. Vermutlich deswegen mussten sich Forschende als persönlich ‚würdig‘ erweisen und konnten nicht nur auf eine Institution verweisen, um ihre Qualifikation auszuweisen.
4 Bewegungen entlang ihres Verhältnisses zum Staat bewerten. Ein paar Gedanken für die Bewegungswissenschaft
Man kann beide Forschungsvorgänge nicht direkt vergleichen, darauf waren sie auch gar nicht angelegt. Doch was bleibt ist die Beobachtung, dass in meinem (akademischen) Umfeld bestimmte Annahmen über das Feld herrschten, und an mich herangetragen wurden, die so gar nicht gegenstandsadäquat waren.
Es gab in akademischen Diskussionen der letzten zwei Jahre sehr viel Raum für die Diskussion, wie die Corona-Proteste am besten einzuordnen seien, aber wenig darüber, wie mit ihnen im Forschungsvorgang umzugehen sei. Das soll jetzt kein Plädoyer dafür sein, dass man alle Bewegungen, denen man sich politisch entfernt fühlt, genauso behandelt wie solche, die man vielleicht sogar aktiv unterstützen möchte. Aber auf der analytischen Ebene ist es, beispielsweise im Sinne einer verstehenden Soziologie (Helle 1977), essenziell, so analytisch offen wie möglich an den Gegenstand heranzutreten. Da unterscheidet sich die Untersuchung von Aktivist:innen nicht von der anderer Personengruppen und sozialwissenschaftlicher Forschungsgegenstände: durch zu starke normative Vorannahmen und „Ängste vor dem Feld“ (Lindner 1981) ist die Möglichkeit eingeschränkt, die tatsächliche Bandbreite von Einstellungsrepertoires und Sinndeutungen der untersuchten Personengruppe abzubilden. Sowohl die Ferne als auch die gefühlte Nähe zum Gegenstand können da problematisch sein. Zumindest in die Forschung zu (Migrations-)Aktivismus habe ich genug Einblick, um zu wissen, dass in Publikationen Themen ausgespart blieben, die eigentlich auch wichtig wären, aber man sich der öffentlichen Darstellung der Bewegung verpflichtet fühlt (aber das wäre ein anderer Text).
Aktivismus passiert nicht im luftleeren Raum. Wenn man sich die beiden von mir beschriebenen Fälle ansieht, so lässt sich leicht ableiten, wie politische und gesellschaftliche Normen die Zugänglichkeit von Aktivist:innen gestalteten. Das mag nicht zu sehr überraschen. Es ist aber wichtig sich bewusst zu halten, dass auch Protestforschende Teil der gesellschaftspolitischen Kräfte sind und ihre eigene Positionierung den Zugang mitgestaltet.
Die politische Landschaft verändert sich, denn einerseits sind heute Werte, die einst mit der liberalen Linken assoziiert waren in den gesellschaftlichen und (regierungs-)politischen Mainstream gewandert, andererseits erstarken rechte und andere Akteure als Bewegungen. Für die Protest- und Bewegungsforschung als wissenschaftlicher Subdisziplin steht damit eine erneute Reflektion an: Wo ist man Forschung für und wo ist man zunächst Forschung zum Erkenntnisgewinn? Wie sind Ergebnisse aus einer Bewegung auf andere übertragbar? Anstatt Bewegungen entlang ihrer politischen Koordinaten einordnen zu wollen, ist es vielleicht analytisch gewinnbringender sie – noch bewusster als eh schon üblich – in ihrem Verhältnis zum Staat und der gesamtgesellschaftlichen Dynamiken zu betrachten.
Dieser Text begann mit der These, dass Einschätzungen über den Zugang zu bestimmten Gruppen oft mehr über die Zugang Suchenden aussagen als über die Beschaffenheit der Gruppen selbst. Ich denke, für die Kreise der Bewegungsforschung sagen sie etwas darüber aus, wie „linke“ Bewegungsforschende ihre Gegenstände kategorisieren und sich selbst zu ihnen positionieren. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Die Autorin ist Mitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb). Sie promovierte an der Universität Bremen zu Flüchtlingsaktivismus und den darin entstehenden Solidaritätsbeziehungen zwischen westlichen Bürger:innen und Geflüchteten. Zurzeit forscht sie im von der Volkswagenstiftung geförderten Drittmittelprojekt „Emergent Norms in Corona Protests?“ (HSU Hamburg und Hamburger Institut für Sozialforschung), zu den Protesten gegen die Coronamaßnahmen.
Die seit Anfang März 2020 zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ergriffenen Maßnahmen haben zu anhaltenden öffentlichen Protesten geführt. Von einzelnen Protestereignissen kam es rasch zu einer breiteren Mobilisierung diverser Personengruppen, deren Zusammenspiel nicht nur die Beteiligten, sondern auch politische und (sozial-)wissenschaftliche Beobachter:innen als Bewegung begriffen. Diese brachte Künstler:innen und Intellektuelle, die sich selbst zum linken Spektrum zählen, mit Unternehmer:innen und Selbstständigen, mit Naturheilkundler:innen und Anhängern verschiedener spiritueller Bewegungen sowie mit bekennenden Rechtsradikalen zusammen. Diese Akteurskonstellation entzieht sich gängigen politischen Einordnungen. Dies wirft zum einen die Frage auf, wie die Beteiligten zusammenfinden und wie sie an einer mehr oder weniger geteilten Auffassung ihrer persönlichen Situation und der gesellschaftlichen Lage „arbeiteten“. Zum anderen ergibt sich aus einem sozialwissenschaftlichen gewissen Ringen um das Verständnis der Akteurskonstellationen auch die Frage, wie diese adäquat beforscht werden kann und sollte. Dies sind Themen, welche im Drittmittelprojekt „Emergent Norms in Corona Protests?“, welches an der Helmut-Schmidt-Universität und dem Hamburger Institut für Sozialforschung angesiedelt ist, nachgegangen wird. Um das Phänomen besser zu verstehen, wurde eine digitale Ethnographie in einschlägigen sozialen Medien vorgenommen und Interviews mit Protestierenden in Hamburg durchgeführt. Das Forschungsprojekt, welches im Juli 2021 startete (und damit vergleichsweise spät nach Beginn der Pandemie und der Proteste), reiht sich ein in eine dynamische Forschungs- und Publikationslandschaft zum Phänomen. Der hier vorliegende Text ist auch ein Ergebnis der Meta-Reflektion dieser Landschaft und dem Versuch, die bereits generierte Wissensproduktion zum Phänomen einzuordnen. Neben den inhaltlichen Erkenntnisinteressen dient das Vorhaben auch der Exploration von Fragen der Archivierung von in hohem Maße digitalisierten sozialen Bewegungen, wie es die Maßnahmenproteste während der Pandemie waren. Hierfür kooperiert es mit dem Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung.
Über die Autorin
Leslie Gauditz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Drittmittelprojekt „Emergent Norms in Corona Protests?“, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
Literaturverzeichnis
Benz, Wolfgang (Hg.) 2022: Querdenken: Protestbewegung zwischen Demokratieverachtung, Hass und Aufruhr. Berlin: Metropol.
Braun, Katherine/Georgi, Fabian/Matthies, Robert/Pagano, Simona/Rodatz, Mathias/Schwertl, Maria 2018: Umkämpfte Wissensproduktionen der Migration. Editorial. In: movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 4(1), 9–27.
Bundesamt für Verfassungsschutz 2023: Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, https://www.verfassungsschutz.de/DE/themen/verfassungsschutzrelevante-delegitimierung-des-staates/verfassungsschutzrelevante-delegitimierung-des-staates_node.html.
della Porta, Donatella (Hg.) 2018: Solidarity Mobilizations in the ‘Refugee Crisis’: Contentious Moves. Cham: Springer International Publishing.10.1007/978-3-319-71752-4
Deps, P.D./Rezende/Andrade, M.A.C./Collin, S.M. 2022: Ethical issues in research with refugees. In: Ethics, Medicine and Public Health 24, 1–7.10.1016/j.jemep.2022.100813
Diefenbach, Aletta/Knopp, Philipp/Kocyba, Piotr/Sommer, Sebastian 2019: Politische Differenz und methodische Offenheit. Wie rechte Bewegungen erforschen? In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen 32(3), 458–469.10.1515/fjsb-2019-0051
Forschungsjournal Soziale Bewegungen ohne Datum: Über uns. https://forschungsjournal.de/ueber-uns/.
Frei, Nadine et al. 2021: „Liebe, Freiheit, Frieden“. Ethnographische Beobachtung des Corona-Protests in Konstanz. Basel: Philosophisch-historische Fakultät Universität Basel. 22.10.31235/osf.io/vzf6aSuche in Google Scholar
Frei, Nadine/Nachtwey, Oliver 2022: Quellen des „Querdenkertums“. Eine politische Soziologie der Corona-Proteste in Baden-Württemberg. SocArXiv, https://osf.io/8f4pb.10.31235/osf.io/8f4pb
Gauditz, Leslie Carmel 2019: Feldausstieg in der Forschung zu Flucht_Migration: Vom Mythos der Distanz. In: Kaufmann, Margrit E./Otto, Laura/Nimführ, Sarah/Schütte, Dominik (Hg.): Forschen und Arbeiten im Kontext von Flucht. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 261–282.10.1007/978-3-658-28380-3_12
Ginsburg, Tobias 2021: Die Reise ins Reich: unter Rechtsextremisten, Reichsbürgern und anderen Verschwörungstheoretikern. aktualisierte, überarbeitete Neuausgabe. Hamburg: Rowohlt.
Gotto, Bernhard/Mecking, Sabine 2021: Special Issue Introduction. Unwelcome participation: ostracizing public protest in the second half of the twentieth century. In: Moving the Social 66, 5–20.10.46586/mts.66.2021.5-20
Grande, Edgar/Hutter, Swen/Hunger, Sophia/Kanol, Eylem 2021: Alles Covidioten? Politische Potenziale des Corona-Protests in Deutschland. WZB Discussion Paper ZZ 2021-601. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Hanloser, Gerhard 2021: „Nicht rechts, nicht links“? Ideologien und Aktionsformen der „Corona-Rebellen“. In: Sozial.Geschichte Online 29, 175–217, https://sozialgeschichteonline.files.wordpress.com/2021/02/sgo_29_vorveroeffentlichung_hanloser_coronarebellen.pdf.
Helle, Horst Jürgen 1977: Verstehende Soziologie und Theorie der Symbolischen Interaktion. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag.10.1007/978-3-663-13890-7
Hentschel, Christine 2021: „Das große Erwachen“: Affekt und Narrativ in der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. In: Leviathan 49(1), 62–85.10.5771/0340-0425-2021-1-62
Interface 2023: Who we are, https://www.interfacejournal.net/who-we-are/.
Jaspal, Rusi/Nerlich, Brigitte 2022: Social representations of COVID-19 skeptics: denigration, demonization, and disenfranchisement. In: Politics, Groups, and Identities, 1–21.10.1080/21565503.2022.2041443
Krause, Ulrike 2016: Feldforschung, Gefahren und Schadensminimierung. In: FluchtsforschungsBlog, https://fluchtforschung.net/blogbeitraege/feldforschung-gefahren-und-schadensminimierung/.
Lindner, Rolf 1981: Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung als Interaktionsprozess. In: Zeitschrift für Volkskunde 77(1), 51–66.
Müller, Pia 2022: Extrem rechte Influencer*innen auf Telegram: Normalisierungsstrategien in der Corona-Pandemie. In: ZRex – Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung 2(1), 91–109.10.3224/zrex.v2i1.06
Nachtwey, Oliver/Schäfer, Robert/Frei, Nadine 2020: Politische Soziologie der Corona-Proteste. SocArXiv, https://osf.io/preprints/socarxiv/zyp3f/.10.31235/osf.io/zyp3f
Opheys, Catrin/Bremer, Helmut 2022: Proteste gegen die „Corona-Politik“ und das politische Feld. Die Notwendigkeit ungleichheitssensibler Zugänge in der politischen Erwachsenenbildung. In: Magazin Erwachsenenbildung.at 16 (46), 53–64.
Pantenburg, Johannes/Reichardt, Sven/Sepp, Benedikt 2021: Wissensparalleltwelten der „Querdenker“. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 29–66.
Rosenberger, Sieglinde/Stern, Verena/Merhaut, Nina (Hg.) 2018: Protest Movements in Asylum and Deportation. Cham: Springer International Publishing.10.1007/978-3-319-74696-8
Salheiser, Axel/Richter, Christoph 2020: Die Profiteure der Angst? – Rechtspopulismus und die COVID-19-Krise in Europa. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/covid19-und-rechtspopulismus.
Schließler, Clara/Hellweg, Nele/Decker, Oliver 2020: Aberglaube, Esoterik und Verschwörungsmentalität in Zeiten der Pandemie. Neue Radikalität – alte Ressentiments Leipziger Autoritarismus Studie 2020. In: Brähler, Elmar (Hg.): Autoritäre Dynamiken. Gießen: Psychosozial-Verlag, 283–308.10.30820/9783837977714-283
Speit, Andreas 2021: Verqueres Denken. Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. 1. Auflage. Berlin: Ch. Links Verlag.
Teune, Simon 2021: Querdenken und die Bewegungsforschung – Neue Herausforderung oder déjà-vu? In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen 34(2), 326–334.10.1515/fjsb-2021-0029
Teune, Simon/Ullrich, Peter 2018: Protestforschung mit politischem Auftrag? In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen 1–2(31), 418–425.10.1515/fjsb-2018-0047
Waldhaus, Christoph 2021: Von Covidioten, Corona Leugnern und anderen rechten Verschwörungstheoretikern. Eine Analyse medialer Frames. In: Synergies Pays germanophones 14, 45–60.
- Es ist bis zu einem gewissen Grad normal und legitim, dass gewisse Forschungszirkel eigene Maßstäbe und Kriterien setzen. Problematisch wäre dies nur, wenn es nicht reflektiert und gegebenenfalls angepasst würde. Denn eine Subdisziplin, die den Anspruch erhebt, etwas über bestimmte, außerparlamentarische, politische Dynamiken (soziale Bewegungen) auszusagen, dabei aber nur einen Teilbereich der Gesellschaft als die Norm setzt (sog. progressive Inhalte), hätte mindestens
ein methodisches Problem. ↩︎ - Eine vergleichbare, große Studie zu deutschen Medien ist mir nicht bekannt. Eine Qualitative Inhaltsanalyse zu den Berliner Demonstrationen im August 2020 zeichnet das negative Framing der Protestierenden als „Covidioten“ in deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Medien nach, nutzt aber eine sehr kleine Fallzahl (Waldhaus 2021) ↩︎
- Siehe dafür aber 2023 erscheinende Publikationen der Autorin. ↩︎
Foto: Querdenken-Demonstration in Ulm, Juni 2020 (cc-by-sa Wald-Burger8 via Wikimedia)