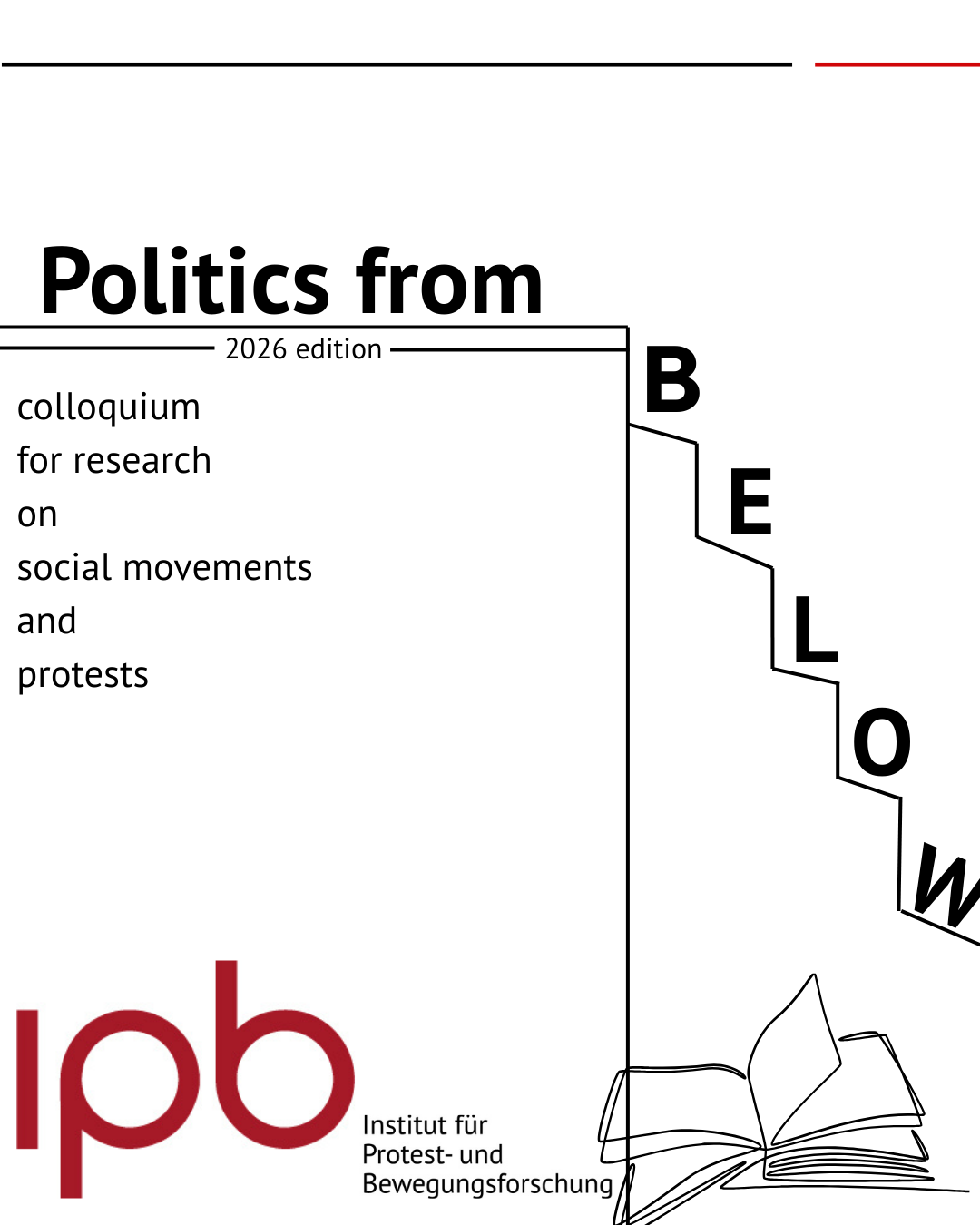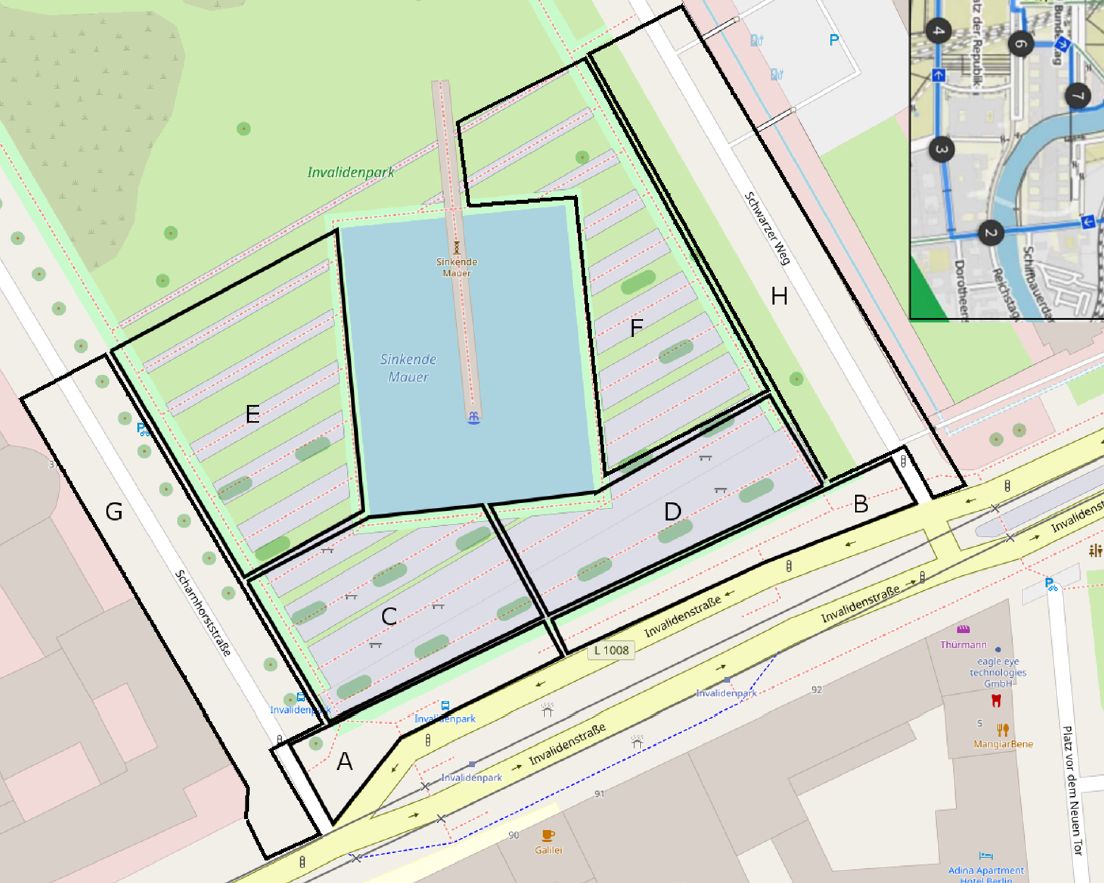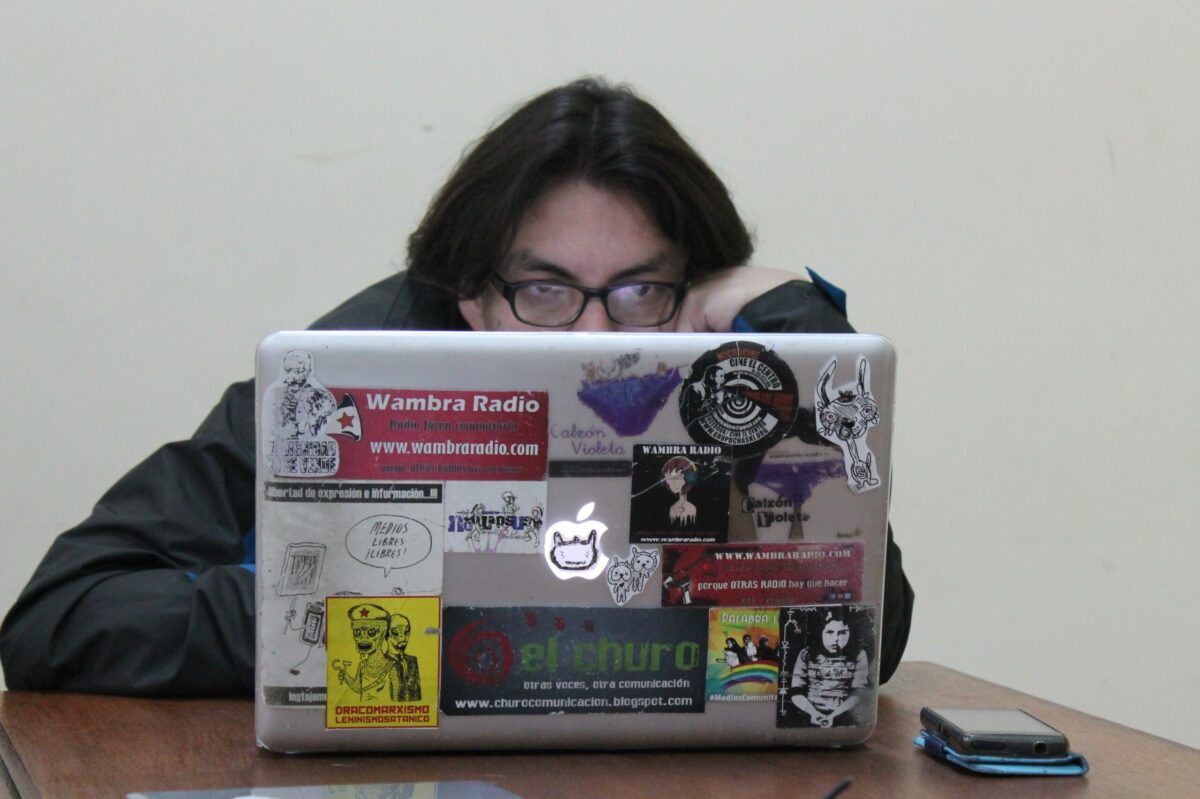Seit 2018 schreiben Autor*innen des ipb in einer eigenen Rubrik des Forschungsjournals Soziale Bewegungen: “ipb beobachtet”. Die Rubrik schafft einen Ort für pointierte aktuelle Beobachtungen und Beiträge zu laufenden Forschungsdebatten und gibt dabei Einblick in die vielfältige Forschung unter dem Dach des ipb.
Zu den bisher erschienenen Beiträge, die alle auch auf unserem Blog zu lesen sind, geht es hier.
Der folgende Text von Lena Herbers erschien unter dem gleichen Titel im Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 36, Heft 2.
Spätestens seit dem Frühjahr 2022 ist durch den regelmäßigen Protest der Aktivist*innen der „Letzten Generation“ (LG) eine gesellschaftliche Debatte darüber entbrannt, wie weit Protest gehen darf, ob z. B. Autobahnblockaden eine Zumutung für die Bevölkerung seien oder vielleicht gerade genau richtig angesichts der fortschreitenden Klimakrise. Aus wissenschaftlicher Perspektive lässt sich zunächst feststellen, dass die Protestaktionen, anders als vielfach medial und gesellschaftlich angenommen, keine Eskalation des Klimaprotests hierzulande darstellen. Ziviler Ungehorsam war und ist ein häufig genutztes Protestmittel der Klima- und Umweltbewegungen. Protestierende versuchen sich mit Besetzungen und Blockaden auf Straßen oder in Kohlegruben Gehör zu verschaffen. Diese Aktionsformen werden von Aktivist*innen genutzt, um einerseits dem eigenen Anliegen eine stärkere Sichtbarkeit zu verleihen und andererseits zu zeigen, dass die eigenen Forderungen auch zumindest kurzzeitig durchgesetzt werden können, indem beispielsweise der Autoverkehr oder der Kohleabbau kurzfristig still steht (vgl. Braune 2017: 28–31; Ebert 2012: 61).
In der gesellschaftlichen und politischen Diskussion darüber, wie weit dieser Protest gehen darf und wo Grenzen sind, liegt der Fokus hingegen vor allem auf der rechtlichen Ebene – auf Straftaten, Strafen und möglichen Strafverschärfungen. So äußerte sich Anfang Februar 2022 der deutsche Justizminister Marco Buschmann per Kurznachrichtendienst Twitter etwa zur Rechtswidrigkeit von Sitzblockaden LG: „Ziviler Ungehorsam ist im deutschen Recht weder Rechtfertigungs- noch Entschuldigungsgrund. Unangemeldete Demos auf Autobahnen sind und bleiben rechtswidrig.“1 Ende November 2022 forderte Andreas Scheuer von der CSU auf derselben Plattform die Innenministerin und den Justizminister dazu auf, die „Klima-Kriminellen“2 einfach wegzusperren und zur gleichen Zeit sprach CDU-Parteichef Friedrich Merz im Kontext der Blockade auf dem Berliner Flughafengelände davon, dass „draußen Ruhe“ ist, solange die „Straftäter“ in Haft sind.3 CDU und CSU forderten im Januar 2023 in einem Vorschlag im Rechtsausschuss des Bundestages zudem härtere Strafen für „Straßenblockierer[*innen] und Museumsrandalierer[*innen]“.4 Dass es nicht nur bei Forderungen bleibt, zeigte sich in Bayern: In München wurde das Festkleben an Straßen temporär verboten und andernorts wurden Aktivist*innen in Präventivhaft genommen.
Die Frage nach der Rechtswidrigkeit disruptiver Protestformen wie der Sitzblockaden lässt sich jedoch nicht so leicht beantworten, wie es der Bundesjustizminister erscheinen lässt. Vielmehr beschäftigt diese Frage auch Gerichte und die Rechtswissenschaft. Um diese rechtliche Auseinandersetzung mit Aktionen zivilen Ungehorsams wird es in diesem Artikel gehen.
Viel Bekanntes im neuen Format
Die Kämpfe um die Einordnung von Aktionen des zivilen Ungehorsams sind nicht neu, sondern in eine länger bestehende Debatte eingebunden und damit Teil der Geschichte von Protestbewegungen in Deutschland: Als Praxis sozialer Bewegungen kommt ziviler Ungehorsam in Deutschland seit den 1970er Jahren vor, vor allem im Kontext der Proteste gegen den NATO-Doppelbeschluss und Atomanlagen (vgl. Stratenwerth 1990: 260). Auch das Kirchenasyl machte wahlweise als „humanitärer Akt […] oder auch als rechtsstaatsgefährdender Rechtsbruch“ (Geis 1997: 60) Schlagzeilen. Blockaden sind dabei ein häufig eingesetztes Mittel, wie bereits Aktionen in Mutlangen und an weiteren Orten in den 1980er-Jahren zeigen. Dabei blockierten Aktivist*innen der Friedensbewegung Zufahrten zu Kasernen und militärischen Einrichtungen, um gegen die Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen zu demonstrieren und Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. Im Nachgang der Proteste entstand eine intensive juristische Auseinandersetzung mit Sitzblockaden und deren Strafbarkeit. Die Gerichte urteilten kontrovers: Die „Judikatur der Bundesrepublik [war] deutlich in Sitzblockaden-freundliche und Sitzblockaden-feindliche Gerichte gespalten“ (Rohrmoser 2021: 347).
Auch die Anti-Atomkraftbewegung nutzte Straßen- und Gleisblockaden aus Protest gegen die Atommüll-Transporte nach Gorleben. Daneben wurde auch der Bau von Anlagen wie beispielsweise dem Atomkraftwerk in Wyhl am Kaiserstuhl oder einer Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf mit Aktionen des zivilen Ungehorsams verhindert. Auf der anderen Seite wurden rechtliche Mittel wie Allgemeinverfügungen dazu genutzt, Proteste an solchen Kristallisationspunkten zu untersagen, was immer wieder zu rechtlichen Auseinandersetzungen um die Versammlungsfreiheit führte.5 Ähnlich handelte zuletzt die Stadt München, als sie im Dezember 2022 mit einer Allgemeinverfügung die Sitzblockaden von Klima-Aktivist*innen untersagte.6 Darüber hinaus wurden Aktivist*innen regelmäßig mit strafrechtlichen Verfahren konfrontiert, zahlreiche Teilnehmer*innen von Sitzblockaden oder Gleisbesetzungen wurden im Anschluss an ihre Aktionen gerichtlich verurteilt.
Vom Protest zur Theorie
Die Geschichte des zivilen Ungehorsams und seiner rechtlichen Betrachtung in Deutschland ist also lang und facettenreich. Noch länger als die politische und juristische Debatte beschäftigt ziviler Ungehorsam aber die Philosophie und politische Theorie – erste Überlegungen stammen aus der Antike, eine intensive Auseinandersetzung begann in den 1960er Jahren zeitgleich mit dem verstärkten Aufkommen von zivilem Ungehorsam als Aktionsform der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und im Rahmen der Proteste gegen den Vietnamkrieg. Dabei steht vor allem die Frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung und Rechtfertigung von zivilem Ungehorsam im Zentrum. Eine Gemeinsamkeit vieler Positionen dieser Debatte ist, dass ziviler Ungehorsam als „moralisch legitimationsfähiger Rechtsbruch“ (Hahn 2008: 1365) beschrieben wird. Auch wenn große Unterschiede hinsichtlich des konkreten Verständnisses bestehen, wann dieser Bestand erfüllt wird, so ordnen die meisten Beiträge zivilen Ungehorsam doch als essenziellen Bestandteil demokratischer Systeme ein.
John Rawls versucht, ähnlich wie auch Ronald Dworkin (1984a; b) und Jürgen Habermas (1983), zivilen Ungehorsam durch bestimmte Anforderungen in einen begrenzten Rahmen einzuhegen: So versteht Rawls zivilen Ungehorsam „als eine[…] öffentliche[…], gewaltlose[…], gewissensbestimmte[…], aber politisch gesetzwidrige[…] Handlung, die gewöhnlich eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen soll“ (Rawls 2020: 401). Ziviler Ungehorsam richtet sich als öffentlicher Appell an den Gerechtigkeitssinn der Mehrheit und bezieht sich auf öffentliche Grundsätze (vgl. Rawls 2020: 403). Ziviler Ungehorsam hat dabei vor allem eine symbolische und kommunikative Bedeutung.
Ein offeneres, radikaldemokratisches Verständnis beruht dagegen auf den Überlegungen von Hannah Arendt (1986), Michael Walzer (1982) sowie Howard Zinn (2013) und wird aktuell unter anderem von Étienne Balibar (2012) und Robin Celikates (2010, 2016) vertreten. Danach ist ziviler Ungehorsam selbst Ausdruck einer politischen Praxis (vgl. Celikates 2017: 39–40), „denn er hat das Ziel und die Funktion, die Dialektik von konstituierender und konstituierter Macht in Gang zu halten oder von Neuem in Gang zu setzen, deren Stilllegung von staatlicher Seite, wenn nicht absichtlich, dann doch nebenbei betrieben wird.“ (2010: 295): Für Celikates ist ziviler Ungehorsam ein „absichtlich rechtswidriges und […] prinzipienbasiertes kollektives Protesthandeln […], mit dem […] das politische Ziel verfolgt wird, bestimmte Gesetze, Maßnahmen oder Institutionen zu verändern (zu verhindern oder zu forcieren)“ (Celikates 2014: 215). Diese Definition ist weitaus offener als die liberale Interpretation von John Rawls.
Ebenso umstritten wie die demokratietheoretische Einordnung sind die spezifischen Bestandteile einer möglichen Definition: beispielsweise die Frage nach der Rolle des Gewissens und der Gewaltlosigkeit, danach ob der Akt des zivilen Ungehorsams öffentlich sein muss, oder inwiefern bei den Handelnden die Bereitschaft bestehen muss, für die Folgen ihrer Handlung einzustehen und inwiefern Bestrafung als Zeichen der Anerkennung des Systems in Kauf genommen werden muss. Letztere Frage bejahen beispielsweise Rawls und Habermas, nicht aber Arendt: Die Bestrafung führe zwar zur Auflösung des Konflikts mit der Rechtsordnung, dennoch hält sie die Bereitschaft der Aktivist*innen zur „Selbstaufopferung“ nicht für nötig, um eine Aktion als zivilen Ungehorsam zu rechtfertigen (vgl. Arendt 1986: 131).
Diese intensive, differenzierte und langjährige Auseinandersetzung mit der Praxis und Funktion von zivilem Ungehorsam, auf die hier nur eklektisch verwiesen werden kann, findet indes in die Realität der Rechtspraxis kaum Eingang. Aktuell nimmt zwar mit der erneuten Popularität dieses Protestmittels auch die juristische Auseinandersetzung mit zivilem Ungehorsam (wieder) Fahrt auf. Die Gerichte in Deutschland beschäftigt aktuell bereits eine Flut an Verfahren zu Aktionen des zivilen Ungehorsams. Vor Gericht geht es allerdings vor allem um die Frage der Strafbarkeit. Dabei spielt die philosophische und sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen nur eine Nebenrolle – trotz der vielfältigen und gut ausgearbeiteten Argumente, wie ziviler Ungehorsam als wichtiger Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft verstanden werden kann.
Recht oder Unrecht?
Aus sich heraus ist ziviler Ungehorsam nicht strafbar, sondern nur, wenn Straftatbestände verwirklicht wurden, insbesondere die folgenden: Öffentliche Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB), Hausfriedensbruch (§ 123 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), Sachbeschädigung (§ 303 StGB), Zerstörung von Bauwerken (§ 305 StGB) oder Störung öffentlicher Betriebe (§ 316b StGB). Bei der Frage nach der Strafbarkeit subsumieren Richter*innen einen vergangenen Sachverhalt unter juristische Normen. Dabei findet eine Interpretation statt: Es wird ausgewählt, was als relevant für den Fall eingeordnet wird und was nicht. Darüber hinaus wird entschieden, ob möglicherweise rechtfertigende oder entschuldigende Gründe bestehen, die zu einem Freispruch führen könnten oder für ein geringeres oder schärferes Strafmaß sprechen. Gerichtliche Urteile sind also keineswegs von vornherein klar, sondern unterliegen Aushandlungsprozessen und sind damit kontingent.
Sitzblockaden – gewaltfrei oder Nötigung?
Umstritten ist dabei vor allem, inwiefern eine Rechtfertigung zivilen Ungehorsams auch im juristischen Sinn möglich ist, wenn strafrechtliche Normen verletzt wurden. Der juristischen Literatur liegt ein Verständnis zugrunde, das sich an die Konzeption von Rawls anlehnt: Danach ist ziviler Ungehorsam eine öffentliche, gewaltlose, gewissensbestimmte, aber bewusst gesetzeswidrige Handlung, die eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen soll (vgl. z. B. Dreier 1983: 60; Fisahn 2012: 304; Radtke 2000: 19–21). In der Rechtspraxis stellt ziviler Ungehorsam hingegen keine eigene Kategorie dar, denn dieses Konzept eignet sich weniger für die strafrechtliche Bewertung (vgl. Radtke 2000: 23 f.). Stattdessen gibt es eine Reihe von richterlichen Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass vermeintlich friedliche Sitzblockaden als gewaltvoll und damit als Nötigung im Sinne des § 240 Strafgesetzbuchs (StGB) eingeordnet werden können.7
Laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müssen dazu erstens Täter*innen eine gewisse körperliche Kraft aufwenden, und zweitens Opfer diese Handlung als körperlichen Zwang empfinden.8 In Bezug auf die Frage, ob Sitzblockaden Gewalt beinhalten, gibt es eine Reihe von Entscheidungen. Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist die sogenannte „Zweite-Reihe-Rechtsprechung“ des Bundesgerichtshofs, die das Bundesverfassungsgericht gebilligt hat.9 Diese Rechtsprechung besagt, dass es zunächst keine Nötigung ist, wenn Autofahrer*innen durch auf der Straße sitzende Aktivist*innen zum Anhalten gezwungen werden, da diese theoretisch über die Aktivist*innen drüber fahren könnten. Aber wenn infolge der Sitzblockade die erste Reihe an Fahrzeugen beide Fahrbahnen versperrt und weitere Autofahrer*innen (in der zweiten Reihe) nicht mehr weiterfahren können, wird diese sekundäre Blockade durch die erste Reihe an Fahrzeugen ebenfalls den Aktivist*innen zugerechnet. Dadurch wird irrelevant, dass sie selbst kein unüberwindbares Hindernis darstellen. Sobald also eine zweite Reihe an Autos anhält, wird das Handeln der Blockierer*innen als gewaltsam verstanden, als eine Kraftaufwendung, die auf die angehaltenen Autofahrer*innen als Zwang wirkt. Es handelt sich dann um eine strafbare Nötigung.
Die Nötigung muss darüber hinaus im Verhältnis zu ihrem Zweck „verwerflich“ sein: Wenn die Sitzblockade durch die Versammlungsfreiheit geschützt ist, ist dies nicht der Fall (vgl. Wihl 2022). Bei Blockaden ist deshalb an dieser Stelle zu klären, ob die Versammlungsfreiheit die Fortbewegungsfreiheit der Autofahrer*innen überwiegt. Dabei darf das Ziel der Versammlung (bei den Sitzblockaden der „Letzten Generation“ der Klimaschutz) nicht bewertet werden, sondern es geht um das Verhältnis zwischen dem Versammlungszweck und der konkreten ausgelösten Behinderung, also der Straßensperre mit ihrer Dauer, Ausweichmöglichkeiten usw.10 Es geht also darum, ob in diesem Fall eine Verbindung zwischen dem blockierten Verkehr und dem Klimaschutz besteht oder ob die Autofahrer*innen zufällig betroffen sind.
Diese Abwägungen bleiben den einzelnen Richter*innen überlassen, deren Urteile ganz unterschiedlich ausfallen können. Beispielsweise wurden am Amtsgericht Freiburg innerhalb von zwei Tagen zwei Aktivist*innen der „Letzten Generation“ für die Teilnahme an derselben Sitzblockade im Februar 2022 einmal freigesprochen und einmal verurteilt. Die jeweiligen Richter*innen vertraten unterschiedliche Rechtseinschätzungen: Einmal wurde argumentiert, dass Autos Teil des Problems der Klimakrise seien und die Nötigung daher nicht verwerflich – der angeklagte Aktivist wurde freigesprochen.11 Im anderen Urteil wurde hingegen darauf verwiesen, dass die blockierten Autofahrer*innen zufällig ausgewählt wurden, ohne die jeweils genutzten Fahrzeuge und ihren konkreten Emissionsausstoß zu berücksichtigen und daher der Zusammenhang zwischen den politischen Zielen und den vom Protest Betroffenen beliebig sei. Somit wurde die Verwerflichkeit der Blockade festgestellt und der Aktivist zu einer Geldstrafe verurteilt.12
Rechtfertigung von zivilem Ungehorsam
Innerhalb der Rechtswissenschaft dominiert die Auffassung, dass eine Rechtfertigung von Aktionen des zivilen Ungehorsams ausgeschlossen ist, wenn Aktivist*innen einen Straftatbestand verwirklicht haben. Dieser Einordnung entsprechen auch ein Großteil der Urteile, auch der obersten Gerichte: Die Klassifizierung einer Straftat als ziviler Ungehorsam reicht nicht aus, „um gezielte und bezweckte Verkehrsbehinderungen durch Sitzblockaden als rechtmäßig zu legitimieren und es den staatlichen Organen zu verwehren, sie als ordnungswidrig oder strafbar zu behandeln“.13
Ein Recht auf Widerstand lässt sich zwar aus Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz (GG) ableiten, aber dieses ist darauf beschränkt, eine Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung abzuwehren. Es gilt nur in Ausnahmesituationen in einem eng umgrenzten Geltungsbereich. Von diesem kodifizierten Widerstandsrecht, das auf die Wahrung der bestehenden Ordnung bzw. die Wiederherstellung des Rechtsstaats gerichtet ist, ist der zivile Ungehorsam zu unterscheiden, der als Ausdruck eines Protests gegen einzelne staatliche Entscheidungen zu verstehen ist und sich damit vielmehr in einem Konflikt mit dem positiven staatlichen Recht befindet (vgl. Schmahl 2007: 119–121). Ziviler Ungehorsam ist also nicht vom Widerstandsrecht des Artikels 20 Abs. 4 GG erfasst (vgl. Wittreck 2018: 61). Die meisten Jurist*innen sehen darüber hinaus keine Möglichkeit einer juristischen Legitimierung von zivilem Ungehorsam (vgl. Isensee 1983; Schmahl 2007; Schwarz 2023). Einen Gesetzesbruch als zivilen Ungehorsam zu deklarieren, hat demnach keine rechtfertigende oder schuldausschließende Wirkung (vgl. Sommermann 2015), sondern liegt „zwingend außerhalb des Gewährleistungsbereichs der Grundrechte“ (Rönnau 2023: 113). Dabei wird allgemein auf die Rechtslage verwiesen, die zivilen Ungehorsam nicht vorsehe: Daher sind die „Taten des zivilen Ungehorsams […] ohne Ansehen der politischen Dimension zu behandeln“ (Karpen 1984: 258).
Trotz dieser verbreiteten Auffassung gibt es abweichende Einschätzungen von Rechtswissenschaftler*innen, Anwält*innen und Richter*innen, die eine Rechtfertigung von Aktionen zivilen Ungehorsams für möglich halten: Diese könnte sich vor allem aus dem rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) oder den Grundrechten ergeben. Der rechtfertigende Notstand regelt die Konfliktsituation zwischen zwei Rechtsgütern. Wenn eine Notstandslage, also eine gegenwärtige Gefahr für ein Rechtsgut besteht, kann in fremde Rechtsgüter eingegriffen werden. Die Handlung muss dann zur Abwehr der Gefahr erforderlich, verhältnismäßig und angemessen sein. Die Tat ist dann nicht mehr rechtswidrig und eine Bestrafung entfällt. Eine gegenwärtige Notlage könnte sich bei den Klimaprotesten beispielsweise aus der Klimakrise ergeben, die eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Eigentum darstellt. Ebenso könnte der Klimaschutz selbst ein schützenswertes Rechtsgut sein. Der zivile Ungehorsam müsste dann erforderlich und angemessen sein, um die Gefahr abzuwehren. Vor diesem Hintergrund beriefen und berufen sich Aktivis*innen vor Gericht immer wieder auf die Gefahren, die etwa durch Pershing II-Raketen, die Atomkraft oder auch die Klimakrise verursacht werden, um ihre Aktionen zu rechtfertigen. Ob dies ein juristisch vertretbarer Weg sein kann, bleibt indes umstritten (vgl. Bönte 2021).
Weitere Möglichkeiten einer Rechtfertigung könnten sich aus verschiedenen Grundrechten ergeben: Wenn die Tat Folge einer Gewissensentscheidung oder eines Glaubens ist und daher nach Artikel 4 Absatz 1, 2 Grundgesetz besonders geschützt ist, könnte dies bei einer strafrechtlichen Verurteilung einbezogen werden (vgl. Radtke 2000: 33–34, 38–39). Außerdem könnte ziviler Ungehorsam auch von den Grundrechten der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit nach den Artikeln 5 Abs. 1, 8 Abs. 1 Grundgesetz erfasst sein (vgl. Dreier 1983: 64–69).
Diese Rechtfertigungsmöglichkeiten von zivilem Ungehorsam stehen allerdings bisher einer „beinahe einhelligen Ablehnung sowohl seitens der Staats- wie der Strafrechtler“ (Roxin 1993: 443) gegenüber, die eine lange Tradition hat (vgl. Rönnau 2023). Ebenso ablehnend stehen die Gerichte zumeist dem Argument von Aktivist*innen und ihrem Rechtsbeistand gegenüber, dass bei der Frage nach der Rechtfertigbarkeit von zivilem Ungehorsam auch Gründe einbezogen werden müssten, die aus juristischer Perspektive nicht unmittelbar mit der Tat zusammenhängen, sondern ihr vorgelagert sind
Klimanotstand oder Straftat?
Dass aber auch in der Rechtspraxis um das Verständnis von zivilem Ungehorsam und seine gesellschaftliche Bedeutung gerungen wird, zeigen verschiedene Urteile von Gerichten aus den letzten Monaten zu Aktionen der „Letzten Generation“. In einem überraschenden Urteil des Amtsgerichts Flensburg aus Dezember 2022 wurde ein Aktivist, der einen Baum besetzt hatte, vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen und zwar erstmals aufgrund des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB), der sich aus dem Klimaschutz ableiten ließ.14 Die Grundlage dafür findet sich in der Staatszielbestimmung für Tier-, Klima- und Umweltschutz gemäß Art. 20a Grundgesetz, die den Staat zu Klimaschutz verpflichtet. Darüber hinaus führte die Richterin auch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 (1 BvR 2656/18) an: Hier nahmen die Richter*innen an, dass die Politik in Bezug auf den Klimaschutz verpflichtet sei, die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu achten und zu schützen. Die Flensburger Richterin nahm an, dass die Baumbesetzung in diesem Fall erforderlich und geeignet gewesen sei, um eine gegenwärtig bestehende Gefahr für den Klimaschutz abzuwehren. Damit widerspricht sie der bisher vorherrschenden Auslegung des rechtfertigenden Notstands (vgl. Schmitz 2023), das Urteil ist insofern „bisher ein juristisches Einhorn“ (Wolf 2022). Gegen das Urteil des Amtsgerichts Flensburg hat die Staatsanwaltschaft Sprungrevision15 eingelegt. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie das OLG Schleswig den Fall beurteilen wird.
In einem früheren Fall aus dem Jahr 2018 wurden Aktivist*innen, die in einen Tierstall eingedrungen sind und die dortigen Missstände filmten, vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen. Das Oberlandesgericht Naumburg sah die Tat in dritter Instanz als gerechtfertigt an, da eine Gefahr für das Tierwohl bestanden habe. Hier verwies das Gericht darauf, dass systematisches Behördenversagen vorlag und es daher keine hinreichende Alternative gewesen wäre, staatliche Behörden einzuschalten.16 Ob diese Überlegungen über das Urteil des AG Flensburg hinaus weiteren Anklang finden, bleibt noch abzuwarten. Denn bisher wurden Aktivist*innen der „Letzten Generation“, die aufgrund von Sitzblockaden angeklagt worden sind, noch nicht wegen des rechtfertigenden Notstands freigesprochen – dass dies im Einzelfall aber rechtlich möglich sei, da der Klimawandel eine Notstandssituation darstelle, meint auch der Richter am rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof Michael Hassemer: „Die Konsequenzen, die der Menschheit durch das Unterlassen von Klimaschutzmaßnahmen entstehen, sind jedenfalls so gravierend, dass Rechtsbeeinträchtigungen durch Protest bis zu einem gewissen Maß durch Notstand gerechtfertigt und darum hinzunehmen sind.“17
Der rechtfertigende Notstand wurde bisher in anderen Verfahren enger ausgelegt: Ein Aktivist, der eine Fassade der Uni ansprühte, um mit der gesprayten Aufschrift, einer Rede bzw. einem Plakat auf deren klimaschädliche Investitionen aufmerksam zu machen, wurde vom AG Lüneburg aufgrund einer Sachbeschädigung verurteilt. Hier entschied das Gericht, dass die Klimakrise zwar eine Gefahr im Sinne des Notstands darstelle; jedoch seien seine Handlungen nicht geeignet, um selbige aufzuhalten und daher nicht gerechtfertigt.18 Das OLG Celle bestätigte als Revisionsinstanz diese Entscheidung und legte darüber hinaus fest, dass die Einordnung als ziviler Ungehorsam selbst keine eigene Rechtfertigungsmöglichkeit für strafrechtlich relevante Protestformen darstellen kann, denn dies wäre mit einer „Selbstaufgabe von Demokratie und Rechtsfrieden durch die Rechtsordnung selbst verbunden“.19
Ausblick
Um die Legitimierung von zivilem Ungehorsam wird in ganz unterschiedlichen Arenen gerungen. Einerseits gesellschaftlich anhand der Frage, welche Art von Protest legitimierbar ist – gerade angesichts einer fundamentalen ökologischen Krise. Andererseits juristisch anhand der Frage, ob Aktivist*innen rechtliche Grenzen übertreten dürfen, was dies bedeutet und inwieweit dabei das Recht an seine Grenzen kommt. Dies wird an der Entwicklung der Rechtsprechung zu Sitzblockaden deutlich. An jüngeren Gerichtsurteilen lässt sich eindrucksvoll zeigen, dass sich politische Aktionen wie jene, die derzeit die Medien bestimmen, trotz ihres bewusst einkalkulierten Rechtsbruchs immer wieder und auf unterschiedliche Weise rechtfertigen lassen: Mit einer versammlungsfreundlichen Auslegung des Nötigungstatbestands, wie am Amtsgericht Freiburg, aber auch über das Aufzeigen eines rechtfertigenden Notstands, wie am Amtsgericht Flensburg. Es handelt sich dabei wohlgemerkt bisher um Einzelfälle, herausgehoben aus einer Vielzahl von Urteilen, mit denen Aktivist*innen insbesondere der Klimabewegung in den letzten Jahren belegt wurden. Dennoch offenbart sich hier, dass Rechtsprechung nicht uniform ist und das Potenzial für einen Wandel bisheriger Auffassungen besteht.
Die Aktionen der Klimabewegung haben in der Rechtsprechung wichtige Aushandlungsprozesse angestoßen – auch wenn diese nicht unbedingt parallel zur gesellschaftspolitischen Debatte um die „Klimakleber“ verlaufen. So wie die gesellschaftliche Diskussion zur Legitimität von Klimaprotesten mit der Verschärfung der Klimakrise weiter voranschreiten wird, werden sich auch die juristische Diskussion und Rechtsprechung zu den Protesten weiterentwickeln. Angesichts der Vielzahl laufender Strafverfahren gegen Klimaaktivist*innen bleibt jedoch abzuwarten, in welche Richtung. In den juristischen Arenen zeigen sich vielfältige gesellschaftliche Verarbeitungen von Normenverschiebungen durch Protestakteur*innen. Die Spielräume sozialer Bewegungen und „Kosten“ bestimmter Protestformen werden gleichzeitig durch die Gerichte mitbestimmt. Für die Protestforschung gilt es deshalb, die rechtliche Auseinandersetzung weiter zu beobachten.
Über die Autorin
Lena Herbers promoviert an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zu gesellschaftlichen Konzeptionen von zivilem Ungehorsam aus der Perspektive der Rechtsprechung sowie von Aktivist*innen im zeitlichen Vergleich (von 1975 bis heute).
Literaturverzeichnis
Arendt, Hannah 1986: Ziviler Ungehorsam. In: Zur Zeit. Politische Essays (1943–1975). Rotbuch, 119–159.
Balibar, Étienne 2012: Gleichfreiheit: politische Essays. Suhrkamp.
Braune, Andreas (Hg.) 2017: Ziviler Ungehorsam: Texte von Thoreau bis Occupy. Reclam.
Celikates, Robin 2010: Ziviler Ungehorsam und radikale Demokratie. Konstituierende vs. konstituierte Macht? In: Bedorf, Thomas/Röttgers, Kurt (Hg.): Das Politische und die Politik. Suhrkamp, 274–300.
Celikates, Robin 2014: Ziviler Ungehorsam – zwischen Gewaltfreiheit und Gewalt. In: Gewaltbefragungen. Beiträge zur Theorie von Politik und Gewalt. transcript, 211–225.10.1515/transcript.9783839425411.211
Celikates, Robin 2016: Rethinking Civil Disobedience as a Practice of Contestation – Beyond the Liberal Paradigm. In: Constellations 23(1), 37–45.10.1111/1467-8675.12216
Celikates, Robin 2017: Veränderungen an sich sind immer das Ergebnis von Handlungen außerrechtlicher Natur. Subjektive Rechte, ziviler Ungehorsam und Demokratie nach Arendt. In: RphZ Rechtsphilosophie 3(1), 31–43.10.5771/2364-1355-2017-1-31
Dreier, Ralf 1983: Widerstand und ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat. In: Glotz, Peter (Hg.): Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat. Suhrkamp, 54–75.
Dworkin, Ronald 1984a: Bürgerrechte ernstgenommen. Suhrkamp Verlag.
Dworkin, Ronald 1984b: Ethik und Pragmatik des zivilen Ungehorsams. In: Meyer, Thomas/Miller, Susanne/Strasser, Johano (Hg.): Widerstandsrecht in der Demokratie: Pro und Contra. L’80 Verlagsgesellschaft, 24–42.
Ebert, Theodor 2012: Erfolg durch Zivilen Ungehorsam? In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen 25(1), 60–65.10.1515/fjsb-2012-0108
Fisahn, Andreas 2012: Verfasstes Widerstandsrecht und der Substanzverlust der Demokratie. In: juridikum 2012(3), 302–312.
Frankenberg, Günter 2006: Das Leben als Sitzblockade oder: Laepples Welt. In: Kritische Justiz 39(1), 97–100.10.5771/0023-4834-2006-1-97
Geis, Max-Emanuel 1997: Kirchenasyl im demokratischen Rechtsstaat. In: JuristenZeitung 52(2), 60–67.
Habermas, Jürgen 1983: Ziviler Ungehorsam – Testfall für den demokratischen Rechtsstaat. In: Glotz, Peter (Hg.): Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat. Suhrkamp Verlag, 29–53.
Hahn, Henning 2008: Ungehorsam, ziviler. In: Gosepath, Stefan (Hg.): Handbuch der politischen Philosophie und Sozialphilosophie – 2: N – Z. de Gruyter, 1365–1367.
Isensee, Josef 1983: Ein Grundrecht auf Ungehorsam gegen das demokratische Gesetz? – Legitimation und Perversion des Widerstandsrechts. In: Streithofen, Heinrich Basilius (Hg.): Frieden im Lande. Bastei Lübbe, 155–173.
Karpen, Ulrich 1984: „Ziviler Ungehorsam“ im demokratischen Rechtsstaat. In: JuristenZeitung 39(6), 249–262.
Linck, Joachim 2011: Protestaktionen gegen Castor-Transporte und das geltende Recht. In: Zeitschrift für Rechtspolitik 44(2), 44–46.
Marxen, Klaus/Rinken, Alfred/Brüggemeier, Gert 1984: Sitzblockaden gegen Raketenstationierung. In: Kritische Justiz 17(1), 44–57.10.5771/0023-4834-1984-1-44
Radtke, Henning 2000: Überlegungen zum Verhältnis vom „zivilem Ungehorsam“ zur „Gewissenstat“. In: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 19–39.
Rawls, John 2020: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Suhrkamp.
Rohrmoser, Richard 2021: „Sicherheitspolitik von unten“: ziviler Ungehorsam gegen Nuklearrüstung in Mutlangen, 1983–1987. Frieden und Krieg. Campus.
Rönnau, Thomas 2023: Grundwissen – Strafrecht: Klimaaktivismus und ziviler Ungehorsam. In: Juristische Schulung (JuS) 2023(2), 112–115.
Roxin, Claus 1993: Strafrechtliche Bemerkungen zum zivilen Ungehorsam. In: Albrecht, Peter-Alexis/Ehlers, Alexander/Lamott, Franziska/Pfeiffer, Christian/Schwind, Hans-Dieter/Walter, Michael (Hg.): Festschrift für Horst Schüler-Springorum: zum 65. Geburtstag.Heymann, 441–457.
Schmahl, Stefanie 2007: Rechtsstaat und Widerstandsrecht. In: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge, 55(1), 99–122.10.1628/joer-2007-0006
Schmitz, Finn-Lauritz 2023: Der „Klimanotstand“ als rechtfertigender Notstand? In: Klima und Recht: KlimR 2(1), 16–20.
Schwarz, Kyrill-Alexander 2023: Rechtsstaat und ziviler Ungehorsam. In: NJW 2023(5), 275–280.
Starck, Christian 1987: Zur verfassungsrechtlichen Beurteilung von Strafurteilen gegen Teilnehmer an Sitzblockaden. In: JuristenZeitung 42(3), 138–148.
Stratenwerth, Günter 1990: Bemerkungen zum zivilen Ungehorsam. In: Oswald, Hans (Hg.): Macht und Recht: Festschrift für Heinrich Popitz zum 65. Geburtstag. Springer, 257–267.10.1007/978-3-322-93609-7_16
Walzer, Michael 1982: Obligations: Essays on Disobedience, War and Citizenship. Harvard Univ. Press.
Wihl, Tim 2022: Legalität von Autobahnblockaden: Die wilde Seite der Demokratie. In: Legal Tribune Online, abrufbar unter https://www.lto.de/persistent/a_id/47534 [abgerufen am 31.01.2022].
Wittreck, Fabian 2018: Verfassungsrechtliche Fragen des Widerstandsrechts heute. In: Schweikard, David P./Mooren, Nadine/Siep, Ludwig (Hg.): Ein Recht auf Widerstand gegen den Staat? Verteidigung und Kritik des Widerstandsrechts seit der europäischen Aufklärung. Mohr Siebeck, 49–68.
Wolf, Jana 2022: Klimaschutz als rechtfertigender Notstand: Zum Freispruch von Klimaaktivist:innen durch das Amtsgericht Flensburg. In VerfBlog, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/klimaschutz-als-rechtfertigender-notstand/ [abgerufen am 31.01.2022].
Zinn, Howard 2013: Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order. Haymarket Books.
- Siehe hierzu: https://twitter.com/MarcoBuschmann/status/1491509094250864645. ↩︎
- Siehe hierzu: https://twitter.com/andreasscheuer/status/1596037092383289345. ↩︎
- Siehe hierzu: https://twitter.com/_FriedrichMerz/status/1596441230644477954. ↩︎
- Siehe hierzu: https://dserver.bundestag.de/btd/20/043/2004310.pdf. ↩︎
- Siehe beispielsweise die Allgemeinverfügung, mit der Demonstrationen am Baugelände des geplanten Kernkraftwerks und seiner Umgebung in Brokdorf untersagt wurden, was nach Urteilen des Verwaltungsgerichts Schleswig und des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg zum „Brokdorf-Beschluss“ des Bundesverfassungsgerichts führte (vgl. BVerfGE 69, 315, Beschluss vom 14.05.1985), der die Versammlungsfreiheit stärkte. Auch im Umfeld von Castor-Transporten wurden regelmäßig Versammlungen entlang der Strecke mit Allgemeinverfügungen untersagt. Auch dazu gab es immer wieder rechtliche Auseinandersetzungen um die Versammlungsfreiheit. ↩︎
- Siehe hierzu: https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:e8d48c86-1310-4f7d-886d-e48c022a1fa9/AV%20Versammlungen%20im%20Zusammenhang%20mit%20Strassenblockaden%20und%20Protestaktionen%20auf%20Autobahnen%20vom%2009.12.2022.pdf. ↩︎
- Dort heißt es: „Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ ↩︎
- Siehe: BVerfG, Beschluss vom 24.10.2001, 1 BvR 1190/90. ↩︎
- Siehe: BVerfG, Beschluss vom 07.03.2011, 1 BvR 388/05. ↩︎
- Siehe BVerfG, Beschluss vom 07.03.2011, 1 BvR 388/05. ↩︎
- Siehe AG Freiburg, Urteil vom 21.11.2022, 24 Cs 450 Js 18098/22. ↩︎
- Siehe AG Freiburg, Urteil vom 22.11.2022, 28 Cs 450 Js 23773/22. ↩︎
- Siehe BVerfGE 73, 206, Urteil vom 11.11.1986 ↩︎
- Siehe AG Flensburg, Urteil vom 06.12.22, 440 Cs 107 Js 7252/22. ↩︎
- Eine Sprungrevision liegt vor, wenn gegen ein erstinstanzliches Urteil, wie hier des Amts gerichts, eine Revision eingelegt wird. Dann wird die zweite Instanz übersprungen und es entscheidet in diesem Fall gleich das Oberlandesgericht, das das erstinstanzliche Urteil überprüft, aber dann aber keine Tatsachenfeststellung mehr betreibt, sondern nur die Rechtsfragen überprüft. ↩︎
- Siehe OLG Naumburg, Urteil vom 22.02.2018, 2 Rv 157/17. ↩︎
- Siehe hierzu: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/verfassungsrichter-in-rlp-findet-notstand-rechtfertigt-radikale-proteste-von-letzte-generation-klima-aktivisten-100.html. ↩︎
- Siehe AG Lüneburg, Urteil vom 12.04.2022, 15 Ds 5102 Js 21930/21. ↩︎
- Siehe OLG Celle, Beschluss vom 29.07.2022, 2 Ss91/22 ↩︎
Foto: Sitzblockade gegen einen Naziaufmarsch in Leipzig, Oktober 2004 (cc-by-sa, Herder3 via Wikimedia)