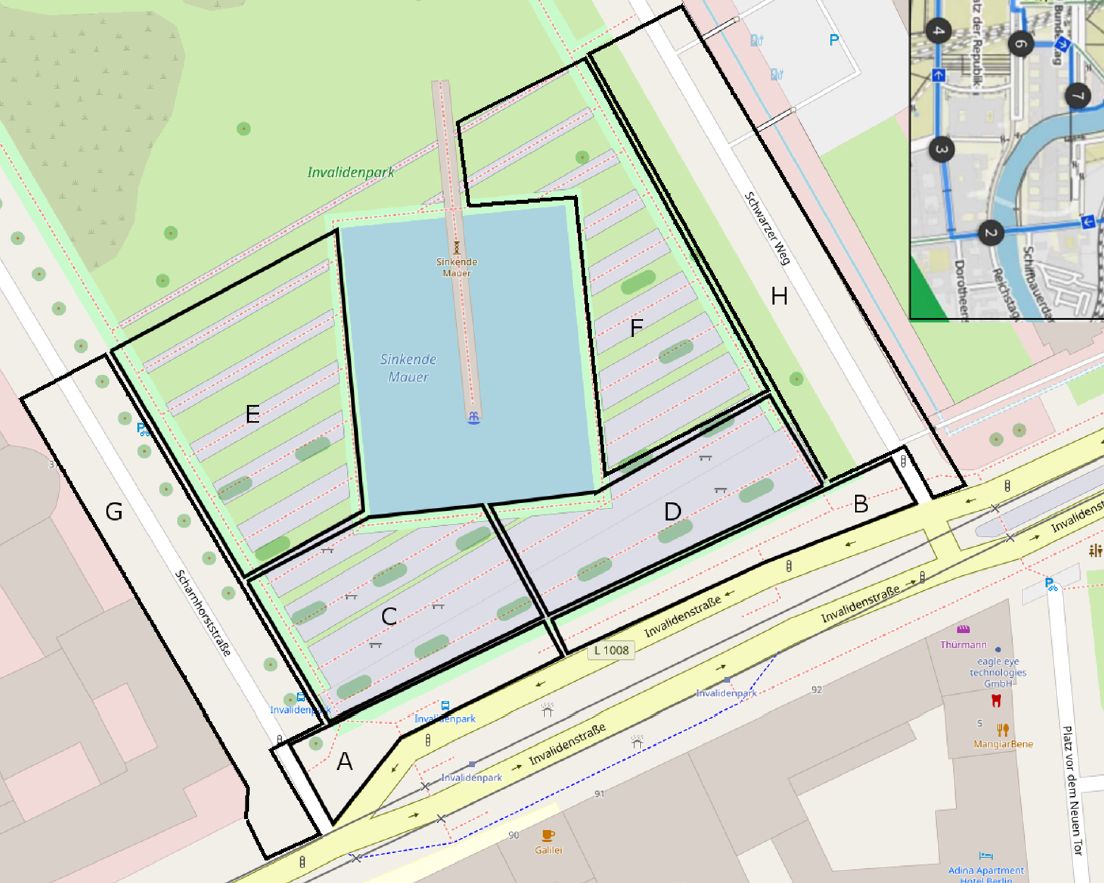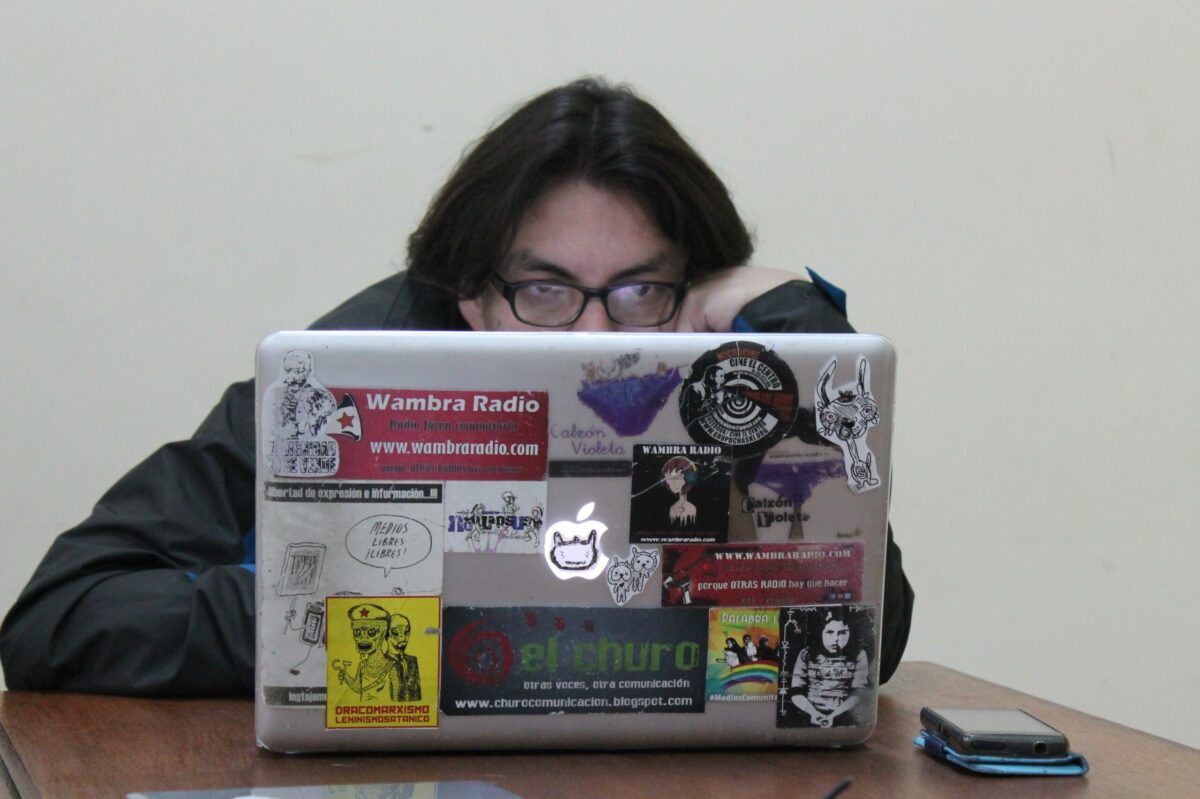Seit 2018 schreiben Autor*innen des ipb in einer eigenen Rubrik des Forschungsjournals Soziale Bewegungen: “ipb beobachtet”. Die Rubrik schafft einen Ort für pointierte aktuelle Beobachtungen und Beiträge zu laufenden Forschungsdebatten und gibt dabei Einblick in die vielfältige Forschung unter dem Dach des ipb.
Zu den bisher erschienenen Beiträge, die alle auch auf unserem Blog zu lesen sind, geht es hier.
Der folgende Text von Andrea Kretschmann und Andreas Fink erschien unter dem Titel “Polizei und Rassismus: Konsolidierung eines neuen Forschungsbereiches?” im Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 35, Heft 4.
1 Rassismus als Forschungsdesiderat
Bekanntlich dominiert im Bereich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Polizei1 bis heute solche Forschung, deren Funktion es ist, „für das System (…) nützlich und notwendig zu sein“ (Foucault 1976: 34). Das Thema Rassismus in der Polizei ist daher randständig, insbesondere im deutschsprachigen Kontext (Hunold/Singelnstein 2022b: 2). Als eine Institution, die sich qua Gesetzesauftrag als unpolitisch zu verstehen hat – das Recht also nur durchsetzen, nicht aber interpretieren soll –, erscheinen der Polizei gerade wissenschaftliche Untersuchungen zu ihrer politischen Dimensionierung als wenig liebsam. Derartige Forschung scheitert in der Regel an der Verschlossenheit des Forschungsfeldes: Die Polizei, die „eine grundlegende Skepsis gegenüber unabhängiger Forschung, Kritik und Kontrolle“ aufweist (ebd.), gewährt in der Regel nur solchen wissenschaftlichen Vorhaben Zugang, die ihr als Institution einen Nutzen versprechen (vgl. Fox/Lundmann 1974; Reichertz 2003: 414; Monjardet 2005). Polizeiforschung wird daher bis heute in aller Regel im Sinne staatsnaher und anwendungsbezogener Forschung betrieben, vorrangig abseits der Universitäten und durch polizeiliche oder außeruniversitäre Einrichtungen. Dabei dominieren organisationssoziologische und -psychologische Fragestellungen. Für potenziell kritische Forschung öffnet sich, wenn überhaupt, die Polizei fast nur intern, da sich die Ergebnisse so als Verschlusssache handhaben lassen. Ursprung und historische Funktion der Polizeiforschung – Regierungswissen zu produzieren – bilden sich daher im Forschungsfeld bis heute stark ab. Didier Fassins für Frankreich formulierte Beobachtung, „Geheimhaltung und Undurchsichtigkeit sind die Regel, Offenlegung und Transparenz die Ausnahme“ (2013: 14, En. i.O.), kann durchaus auch für den hier untersuchten deutschen Kontext Geltung beanspruchen.
Hervorzuheben ist vor diesem Hintergrund die bislang im deutschsprachigen Kontext einzigartige aktuelle Konjunktur der Arbeiten zu Rassismus in der Polizei; Die deutsche Polizei gewährte Wissenschaftler:innen zuletzt in vergleichsweise größerem Maße Forschungszugang. Zurückzuführen ist dies auf eine zunehmende gesellschaftliche Problematisierung der polizeilichen Praxis als rassistisch und entsprechend eines vergrößerten Drucks auf die Polizei, sich gegenüber dieser Thematik zu öffnen. So kommt es derzeit zu einer Verbreiterung der in Deutschland „bereits seit Jahrzehnten geführt(en)“ (Hunold/Singelnstein 2022b: 2) Debatte um das Thema Rassismus in der Polizei. In deren Folge wurden in den letzten Jahren, neben einer Reihe von Studienergebnissen, sowohl einige thematisch einschlägige programmatische Schriften als auch Überblicksbeiträge publiziert. Zuletzt erschienen erstmals auch Überblicksbände (Feltes/Plank 2021a; Hunold/Singelnstein 2022a), die die Bandbreite der Fragestellungen im Themenfeld versammeln.
2 Ein neuer Forschungsbereich
Dies verweist, so unsere These, auf die Konsolidierung eines neuen Forschungsbereichs innerhalb der Polizei- und ein Stück weit auch in der Rassismus- und Diskriminierungsforschung. Dennoch bleiben die Desiderate im Themenfeld vielfältig.
Um der konzeptionellen Breite des Forschungsstandes gerecht zu werden, wird in diesem Beitrag von ethnisierender oder rassialisierender Diskriminierung (nachfolgend abgekürzt Diskriminierung) durch die Polizei gesprochen, verstanden als die Verwendung von imaginären „Gruppen- und Personenkategorien zur Herstellung, Begründung und Rechtfertigung von Ungleichheiten“ (Scherr et al. 2017: V). Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Begriff „Rassismus“ erst in der letzten Dekade dominant Verwendung findet (Atali-Timmer et al. 2022: 42) – fast 40 Jahre nach seiner Einführung in der Migrationsforschung und schwarz-feministischen Diskussionen (Barskanmaz 2019: 119). Während für die 1990er Jahre Untersuchungen entlang des Begriffs der „Fremdenfeindlichkeit“ vorherrschen, zentrieren Studien ab den 2000er Jahren ihr Erkenntnisinteresse verstärkt um das Phänomen „ethnischer Minderheiten“.
Im Forschungsfeld lassen sich drei Stränge zu je unterschiedlichen Gegenstandsbereichen unterscheiden, die wir nachfolgend erörtern: Erstens Forschungen zu Einstellungen, zweitens zu Praktiken und drittens zu Institutionen. Diese sind in starkem Maße miteinander verzahnt und stehen in einem Interdependenzzusammenhang, weshalb die hier angeführte Trennung vor allem analytischen Gesichtspunkten folgt.
3 Einstellungen
Die Erforschung von Einstellungen, Vorurteilen und Stereotypen stellt den gängigsten und zugleich ältesten, dezidiert sozialwissenschaftlichen Zugriff auf das Thema Polizei und Rassismus dar (Hunold/Wegner 2020).2 Die ersten Einstellungsforschungen entstanden unter dem Eindruck einer gesamtgesellschaftlichen Zunahme von ‚Fremdenfeindlichkeit‘ und Diskriminierung so genannter ‚Gastarbeiter‘ oder ‚Asylanten‘ seit den späten 1970er Jahren. Nach pogromartigen Ausschreitungen gegen Asylsuchende und Migrant:innen in Mölln, Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen in den 1990er Jahren gerät die Polizei in die Kritik, aus einer weltanschaulichen Nähe zu den Täter:innen nur zögerlich eingeschritten zu sein. In der Folge gab die Innenministerkonferenz Mitte der 1990er Jahre eine erste Studie zum Thema Fremdenfeindlichkeit in der Polizei in Auftrag (Eckert et al. 1996, 1998; Jaschke 1997). Diese findet bis in die Gegenwart hinein Nachfolgerinnen (HMdIS 2020; Kemme et al. 2020; Krott et al. 2018; Lindner 2001; Mletzko/Weins 1999; Schweer/Strasser 2003; 2008).
Per Fragebogen erheben diese Studien Daten zur politischen Selbstverortung, Stereotypen und Vorurteilen von Polizist:innen in Deutschland. Sie zeigen dabei gefestigte rechtsextreme, rassistische, fremden- oder muslimfeindliche Einstellungen auf, die zwischen fünf und 25 Prozent variieren, wobei diese Zahlen in manchen Studien (siehe z. B. Kemme et al. 2020: 144; Mletzko/Weins 1999: 77) als unproblematisch angesehen werden, da sie sich mit Erhebungen zur Gesamtbevölkerung decken oder sogar darunterliegen. Diese Relativierung wird von einigen Autor:innen inzwischen dahingehend kritisiert, dass die Ansprüche an Polizist:innen aufgrund ihrer besonders grundrechtsinvasiven Eingriffsbefugnisse höher liegen müssten als für die übrige Bevölkerung (z. B. Kempen 2021: 169). Diskriminierende Einstellungen sind laut Einstellungsforschung bei Polizist:innen mit Berufserfahrung stärker ausgeprägt als bei solchen ohne Berufserfahrung (Krott et al. 2018; Kemme et al. 2020); zudem wird vermutet, dass die Integration von interkultureller Kompetenz im Lehrplan der Polizeiausbildung diskriminierende Einstellungen verringert (Krott et al. 2018: 8). Weiter wird eine Diskrepanz zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung im Bezug auf diskriminierende Einstellungen festgestellt, wobei sich Polizist:innen selbst generell als weniger rassistisch beurteilen als ihre Kolleg:innen (Atali-Timmer et al. 2022: 36; Lindner 2001).
Die Ursachen für rassistische Einstellungen, Stereotype oder Vorurteile werden in der Forschung vorrangig in professionellen bzw. polizei-organisationalen Bedingungen gesehen, etwa in schlechten Arbeitsbedingungen, der Überforderung im Dienst oder Erfahrungen von Ohnmacht, weiter in fehlender interkultureller Kompetenz, selektiven Erfahrungen mit Fremden, aber auch dem ethnisierenden Framing von Konflikten in ‚multikulturellen‘ Gesellschaften. Bei der Erforschung von Einstellungen dominieren Untersuchungen auf der Mikroebene mit begrenzter Reichweite (es werden einzelne Dienststellen, Auszubildendenkohorten oder regional begrenzt Gruppen von Polizist:innen befragt).
Die Einstellungsforschung erfährt in verschiedener Hinsicht grundsätzliche Kritik: Der frühen Einstellungsforschung wird ihr individuumszentrierter Fokus vorgehalten, der soziale Situationen und Erfahrungen ausblende und daher ‚fremdenfeindliches Verhalten‘ nicht ausreichend erklären könne (Bornewasser 2009: 18), weshalb spätere Studien ihre auf Basis statistischer Daten generierten Erkenntnisse verstärkt ethnografisch kontextualisieren und reflektieren (vgl. Schweer/Strasser 2003; 2008). Die Kritik betrifft aber auch die theoretisch-begriffliche Basis dieser Studien. In Anlehnung an die Migrationsforschung bringen Forscher:innen im Themenfeld hervor, dass das Konzept der Fremdenfeindlichkeit lediglich die Problematisierung der Feindlichkeit impliziere, nicht aber die für die Feindlichkeit essenzielle Konstruktion des Fremden. Auch der Begriff der Feindlichkeit selbst wird nicht als unproblematisch angesehen, da dieser eine prinzipielle Gastfreundschaft suggeriere, vor deren Hintergrund die Feindschaft als individuelle Ausnahme erscheint. Dies verunmögliche das Erkennen struktureller Faktoren mit Bezug auf das Phänomen (Barskanmaz 2019: 119–127; Terkessidis 2004: 57–71). Zum anderen wird die Untersuchung allein von Einstellungen inzwischen als unzureichend zurückgewiesen. Diese könne immer nur einen Teilaspekt des Phänomens abbilden (Derin/Singelnstein 2022: 171). Ausgehend von Forschungsständen der Migrationsforschung wird argumentiert, dass Rassismus in seinen Erscheinungsformen zu vielfältig sei, als dass er sich auf bewusste Einstellungen und damit einhergehend, intentionale Diskriminierungen, beschränken ließe. So wird z. B. kritisch eingewendet, dass „berufliche Belastungen und Erfahrungen allein kaum zu erklären (vermögen), wie rassistische Einstellungen und Praxen in der Polizei entstehen und sich entwickeln“ (Singelnstein 2021: 385). Insbesondere wird angeführt, dass Diskriminierung durch die Polizei unbewusst – in Form von Stereotypen oder Vorurteilen – auftreten kann. Weiter könne sie (strukturell) in Praktiken, Organisationen und Institutionen eingebettet sein, etwa auch mittels Gesetzen oder polizeiinternen Richtlinien, wo sie sich jenseits der individuellen Ebene qua Routinen auszuprägen vermag. Es ist zudem umstritten, inwieweit Einstellungsforschungen Praktiken überhaupt zu erklären vermögen. Auch vor diesem Hintergrund entwickelte sich seit den 1995er Jahren ein Forschungsstrang, der polizeiliche Praktiken in den Mittelpunkt seines Erkenntnisinteresses stellt.
4 Praktiken
Bereits seit den 1960er Jahren analysiert die Polizeiforschung diskriminierende Handlungen der Polizei, wobei lange Zeit nur auf klassenbezogene Ungleichbehandlung fokussiert wurde (vgl. Herrnkind 2021). Rassialierende oder ethnisierende Diskriminierung problematisierten ab den 1990er Jahren (wenn auch datengestützt) zunächst nur zivilgesellschaftliche Organisationen (vgl. Hunold/Wegner 2020: 27 f.; Püschel 2022: 410 f). Erst in der Folge werden erste sozialwissenschaftliche Viktimisierungsstudien (a) angestrengt; sie bilden einen von zwei Ausprägungen innerhalb des hier erörterten Strangs der Praktiken. Hintergrund dieser Entwicklung sind Ereignisse, die das Thema Polizei und Rassismus immer wieder auf die mediale und politische Agenda setzen, wie etwa die Frage nach der Todesursache des 2005 in einer Gefängniszelle verbrannten Oury Jalloh (Hunold/Singelnstein 2022b: 2). Diese öffentliche Debatte um rassistische Praktiken wird zuletzt anlässlich des 2020 durch rechtswidriges polizeiliches Handeln zu Tode gekommenen George Floyd in den USA in nie dagewesenem Maße befeuert (vgl. Groß/Clasen/Zick 2022; 146). Hinzu kommen die Rolle der Polizei bei den NSU-Ermittlungen, die Aufdeckung rechtsextremistischer Chatprotokolle in der Polizei (Kopke 2022: 128, 135 ff) sowie Berichte zu diskriminierenden Grenz- und Personenkontrollen (KFRP 2019), die in der Öffentlichkeit und einzelnen Parteien die Forderung nach einer bundesweiten Rassismus-Studie über die Polizei laut werden ließen. Zwar erteilte der frühere Innenminister Seehofer dieser eine Absage, jedoch besteht in einigen Bundesländern seitens der Innenministerien gegenwärtig erhebliche Bereitschaft, Forschungszugänge zu gewährleisten.3 Ebenfalls haben seit den 1990er Jahren diesem Zeitraum haben Forschungen zu Diskriminierung im Inneren und an den Staatsgrenzen (b) stark zugenommen.
(a) Waren migrantische Bevölkerungsgruppen für die Polizeiforschung bis in die 1980er Jahre vor allem im Sinne von „Ausländer:innen als Täter:innen“ (Püschel 2022: 407) relevant, rückten diese vor dem Hintergrund vermehrter rassistischer Gewaltstraftaten ab Anfang der 1990er Jahre auch unter viktimologischen Gesichtspunkten in ihr Blickfeld. Hier sind vor allem diejenigen Studien interessant, die sich mit sekundärer und tertiärer Viktimisierung beschäftigen, das heißt mit den ethnisierenden oder rassialisierenden Reaktionen der Polizei gegenüber Opfern von Straftaten. Die meisten diesbezüglichen Studien erheben durch Befragungen von Zeug:innen und Opfern (rechter) Straftaten deren Erfahrungen im Umgang mit der Polizei (Böttger et al. 2014; Gesemann 2003; Nohl 2003; Quent et al. 2017; Sauer 2006; Strobl 1998). Ausnahmen bilden eine Hellfeldstudie des bayrischen LKAs (Luff/Gerum 1995) und eine qualitative Interviewstudie in Sachsen-Anhalt (Asmus/Enke 2016). Andere erheben das Anzeigeverhalten bestimmter Bevölkerungsausschnitte (Leitgöb-Guzy 2021).
Zusammenfassend kommen die Studien zu dem Ergebnis, dass die Polizei Opfer (rechter) Straftaten diskriminiert: Die polizeilich angebotene Hilfeleistung (Luff/Gerum 1995: 223) und Sensibilität sowie Resonanz auf mitgeteiltes Opfererleben variiere mit der Zuordnung zur Eigengruppe (Strobl 1998: 307; Nohl 2003: 77). Bei Betroffenen rechter Straftaten komme häufig eine Täter-Opfer-Umkehr und das ‚Übersehen‘ eines politischen Tatmotivs hinzu (Quent et al. 2017: 26 ff); mit Konsequenzen für das Vertrauen der Betroffenen in die Polizei (Böttger et al. 2014: 121; Gesemann 2003: 222 f). Dies führt unter anderem möglicherweise zu einer geringeren Anzeigebereitschaft von Migrant:innen (Leitgöb-Guzy 2021: 19). Asmus und Enke (2016) bieten des Weiteren einen seltenen Einblick in die Ursachen für diskriminierendes Verhalten gegenüber ethnisierten bzw. rassialiserten Opfern von Straftaten durch die Polizei. Sie kommen zu dem Schluss, dass dieses paradoxerweise gerade aus dem betont neutralen und fachlichen Vorgehen im Umgang mit Migrant:innen resultiere. Demnach nahmen Polizist:innen diese häufig als kulturell fremd wahr und hielten sich deshalb an vermeintlich objektive verfahrenstechnische Routinen. Dies wurde von den Opfern wiederum als gleichgültig, desinteressiert und im Effekt diskriminierend gedeutet (ebd.: 160).
(b) Ein zweiter Forschungsstrang zu polizeilichen Praktiken nimmt das diskriminierende Polizieren im Inneren und an den Grenzen in den Blick. Diesbezüglich werden vor allem Kontrollpraktiken sowie vereinzelt Gewaltanwendungen der Polizei untersucht. Hintergrund dieses thematischen Fokus bilden die Debatten der 1990er Jahre um Einwanderung und Integration, die damit einhergehenden soziodemographischen Transformationen sowie die – vorwiegend im europäischen Ausland beobachteten – gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen migrantischen Jugendlichen und Polizei (vgl. Püschel 2022: 408). Dazu liegen einerseits eine Reihe von quantitativen Befragungen migrantischer Bevölkerungsgruppen oder „ethnischer Minderheiten“ zu ihren Erfahrungen mit der Polizei vor (FRA 2010a/b; 2017; Heitmeyer et al. 1997; Oberwittler et al. 2014; Salentin 2008), anderseits qualitative Interviewstudien (Espín Grau/Klaus 2022; Plümecke/Wilopo 2019) sowie Ethnografien (Hunold 2014; Oberwittler 2016; Schweer/Strasser 2003; 2008). Insgesamt ergeben diese Studien, dass die Adressat:innen Polizeikontrollen in urbanen Räumen oder an Staatsgrenzen als diskriminierend wahrnehmen, weil diese zum einen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes ethnisierend bzw. rassialisierend behandelt, zum anderen häufiger kontrolliert werden. Die ethnografisch ausgerichteten Studien stellen dabei eine Diskriminierung entlang einer sozialraum- und milieuorientierten Polizeipraxis fest (Hunold 2014; Schweer/Strasser 2003); diese sind also abhängig von den polizierten Raumausschnitten und den polizierten sozialen Gruppen zu sehen.
Weiter ist das Forschungsprojekt von Abdul-Rahman et al. (2020) herauszuheben, da es als erstes für den deutschen Kontext durch Rassismus induzierte rechtswidrige Polizeigewalt untersucht. Die repräsentative Studie untersucht mithilfe qualitativer und quantitativer Methoden weiße Personen, People of Color, als auch Polzist:innen selbst. Einzelne Vertreter:innen der letzten Gruppen gaben in Interviews an, rassistisches Verhalten von Kolleg:innen und daraus mutmaßlich resultierende Polizeigewalt beobachtet zu haben (ebd.: 37 f). People of Color und Schwarze Menschen gaben im Vergleich zu weißen Personen zudem deutlich häufiger an, „dass Merkmale der (zugeschriebenen) Herkunft wie ihre zugeschriebene oder faktische kulturelle Zugehörigkeit, Hautfarbe, Nationalität, Name/Sprache oder ihr Aufenthaltsstatus einen Einfluss darauf gehabt hätten, wie sie von der Polizei behandelt wurden“ (ebd.: 30).
Bislang noch relativ unverbunden zum übrigen Forschungsstand sind die stärker im Bereich der Migrationsforschung als der Kriminologie gelagerten Studien zum Thema Polizei und Rassismus an den Außengrenzen. Die Untersuchung von Plümecke und Wilopo (2019) sei an dieser Stelle exemplarisch angeführt. In ihrer Interviewstudie zeigen sie, inwiefern an der Schweizer Grenze etwa Geflüchtete ein besonders hohes Risiko haben, im Zuge von Polizeikontrollen (intersektionale) Diskriminierung und/oder physische Gewalt zu erfahren (ebd.: 152).
Der allgemeinen Tendenz der soeben erörterten Ergebnisse widersprechen hingegen die Erkenntnisse des Forschungsprojektes POLIS, in dem über Interviews, Fragebögen und ethnografische Beobachtungen die Interaktion zwischen Polizei und Jugendlichen in zwei französischen und deutschen Großstädten miteinander verglichen wird: Zwar berichten Befragte häufig von „respektlosem Verhalten von Polizisten gegenüber Dritten“ (Oberwittler et al. 2014: 61), allerdings zeige sich insgesamt keine erhöhte Prävalenz verdachtsunabhängiger Personenkontrollen gegenüber migrantischen Jugendlichen, abgesehen von der Kontrolle von Taschen (Oberwittler 2016: 425; dazu für Frankreich wiederum gegenteilig Jobard/Lévy 2013; 2017).
Mit Bezug auf den Forschungsstrang der Praktiken lässt sich resümieren: Die Zahl der Studien zu rassistischen Polizeipraktiken in Deutschland, insbesondere mit Blick auf Polizeigewalt, ist bislang noch überschaubar. Auch ihre Reichweite ist jeweils beschränkt: Viele der aufgeführten Studien können nur in regionaler Hinsicht Aussagen treffen. Zudem wird die polizeiliche Perspektive nur selten miterhoben. In einer Zusammenschau der Studien, die sieben Bundesländer und mehrere bundesweite Erhebungen mit großen Fallzahlen umfassen, ergibt sich jedoch annähernd ein flächendeckendes Bild zu rassistisch diskriminierenden Praktiken der Polizei. Für viele Autor:innen weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass die iskriminierenden Praktiken der Polizei nicht nur als Einzelfälle, sondern als institutionalisiertes Handeln verstanden werden müssen (z. B. Bosch/Thurn 2022; Legnaro 2020: 629). Damit ist die Ebene struktureller Einlagerung und Reproduktion von Rassismus in der Polizei angesprochen, auf die nachfolgend eingegangen wird.
5 Organisationen, Kriminalpolitik, Gesellschaft
Ein vergleichsweise stärker theoretisch geprägter Strang besteht in Forschungen, die sich mit der Ebene der Organisation, der Kriminalpolitik und/oder dem weiteren gesellschaftlichen Kontext beschäftigen. Sie ziehen ebenfalls den Begriff des Rassismus heran, wobei dieser – implizit oder explizit – als institutionell, d. h. in einem strukturellen Sinne (Karakayali 2022: 24 ff), verstanden wird.
Das Konzept des institutionellen Rassismus grenzt sich von dem Verständnis eines Rassismus als individuellem Phänomen ab und interessiert sich für die „Regeln und Routinen, mit denen die Organisationen den an sie gestellten Aufgaben nachkommen“ (ebd.: 25). In den Blick genommen werden mithin institutionelle Ordnungsstrukturen mit Bezug auf Rassismus. Von institutionellem Rassismus wird im Forschungsfeld ausgegangen, „wenn eine diskriminierende Differenzierung anhand der Zuschreibung ethnischer Kriterien in der Organisation der Polizei für Einzelne, unabhängig von deren Intention bzw. der Einstellung, handlungsleitend wird“ (Bosch/Thurn 2022: 187). Untersucht wird dabei, inwiefern etwa die Kriminalisierung bestimmter Räume (Hunold et al. 2021), gesetzliche Vorgaben und Richtlinien (Cremer 2013; Herrnkind 2000, 2014), formalisierte oder informelle Wissensbestände und darauf basierende Verdachtskonstruktionen (z. B. Behr 2019; End 2019; Liebscher 2020; Reichertz 1990; Schöne/Herrnkind 2020) ethnisierende bzw. rassialisierende Diskriminierungen zum Ergebnis haben, auch dann, wenn sie „ihrer Erscheinung bzw. Form nach fair und nicht unmittelbar diskriminierend“ scheinen (Bosch/Thurn 2022: 189).
Beispielsweise zeigt Cremer für den gesetzlichen Rahmen des Artikel 22 Bundespolizeigesetz, dass es „sich bereits aus der Norm selbst (ergibt), aus ihrem Zweck, dass sie auf Diskriminierungen angelegt“ (2013: 898) und somit grundrechtswidrig ist. Das Gesetz ermächtigt Bundespolizist:innen, jede Person zur Kontrolle der Aufenthaltsberechtigung an Bahnhöfen oder Flughäfen anzuhalten. Da diese Befugnis nicht an ein rechtlich definiertes Verhalten von Verdächtigen gebunden ist, legt es den Beamt:innen nahe, den möglicherweise illegalen Aufenthaltsstatus allein aufgrund äußerlicher Merkmale, sprich: des Phänotyps zu vermuten. Markus End (2019) stellt fest, dass die Polizei bis in die 2000er Jahre aus dem 19. Jahrhundert stammende Personenkarteien zur sogenannten „Zigeunerkriminalität“ teils bruchlos fortführte. Zwar verwendete sie dabei neuere, korrekter erscheinende Gruppenbezeichnungen, die auf tatsächliche Straftatbestände bezogen sind – die ethnisierende Codierung dieses formalisierten Wissensbestandes lässt Sinti und Roma aber weiterhin häufiger in den Ermittlungsfokus der Polizei rücken (vgl. Egbert 2018). Für ein bis 2016 verwendetes Polizeilehrbuch haben Schöne und Herrnkind (2020) aufgeführt, dass dort NS-Kriminologen und ihre rassenhygienischen Theorien („Sippenforschung“ etc.) kontextlos übernommen wurden.
An das Konzept des institutionellen Rassismus knüpfen auch aktuelle Diskussionen um Racial Profiling an, die jedoch im öffentlichen Diskurs deutlich stärker als in der Forschung und bei Letztgenannter vor allem in Form theoretischer Erörterungen vertreten sind (Behr 2018; Belina 2016; Bosch/Thurn 2022; Bruce-Jones 2015). Racial Profiling beschreibt ein Phänomen, das über individuelle Einstellungen oder konkrete Praktiken hinausreicht, da es auf der kollektiven bzw. institutionellen Ebene gelagert ist (vgl. Singelnstein/Niemz 2022: 340 f). In seiner engen Definition bezeichnet es „polizeiliche Strategien der Verdachtsgenerierung, die sich an äußeren Kennzeichen der (vermeintlichen) ethnischen Herkunft orientieren und Kontrollaktivitäten entsprechend ausrichten“ (Legnaro 2020: 629). Die weite Definition integriert hingegen auch eine indirekte Form der Diskriminierung, bei der die Entscheidungsfindung und die allgemeine Praxis potenziell rassistische Ergebnisse produzieren (Miller et al. 2008: 165). Originäre sozialwissenschaftliche empirische Studien zu Racial Profiling existieren für Deutschland – im Gegensatz zum internationalen Forschungsstand (für Frankreich z. B. Jobard/Lévy 2013, 2017) – bislang nicht. Die in 3. aufgeführten Studien zu polizeilichen Praktiken liefern jedoch Indizien für den deutschen Kontext, insofern diese teils auch institutionelle Dimensionen in den Blick nehmen und diese als Ethnic oder Racial Profiling bezeichnen. So untersuchen Hunold et al. (2021) in einer aus Interviews und Beobachtungen bestehenden Ethnografie Narrative von Polizist:innen zu städtischen Räumen. In den Beschreibungen der Interviewten zu „besser“ und „schlechter gestellten“ Stadtteilen setzen die Polizist:innen physische und soziale Merkmale miteinander in Beziehung: Der schlechtere Stadtteil – „gruselig, dreckig, heruntergekommen, nicht einladend“ (ebd.: 28) und mit für die Polizei potentiell bedrohlichen Gewaltdelikten assoziiert – wird anhand der dort vermeintlich lebenden ethnischen Minderheiten umschrieben, der bessere hingegen mittels Schilderungen architektonischer Merkmale. Den Autor:innen zufolge reflektierten solche Raumorientierungen der Polizist:innen „vor allem soziale Merkmale wie Geschlecht, Ethnie und Klasse, über die Ein- und Ausschlussprozesse durch die damit verknüpften und legitimierten polizeilichen Maßnahmen strukturiert werden“ (ebd.: 21).
Insgesamt bleibt die Frage nach der Existenz von institutionellen Rassismus und Racial Profiling in der Polizeiforschung jedoch umstritten. So bezweifeln einige führende Kriminologen teils dessen Existenz zugunsten eines individuellen Rassismus (so etwa Feltes/Plank 2021b: 274; Behr 2017). Konzeptionell geht Behr beispielsweise von einem „Widerstreit zwischen formalisierter Polizeikultur und informaler Cop Culture“ aus: „Einzelne Beamte der Polizei können also auf Ebene der Einstellung rassistische Dispositionen besitzen oder rassistisch handeln, ohne dass diese in (formal oder informal) institutionalisierte Praktiken bzw. institutionalisiertes Wissen überführt werden.“ (Bosch/Thurn 2022: 185; vgl. Behr 2008, 2019)
Eine weitere, für den deutschsprachigen Raum bisher kaum erforschte Perspektive versteht polizeilichen Rassismus vor allem als Folge eines historisch gewachsenen, gesellschaftlich und strukturell verankerten Rassismus (Behr 2019). Dieser Forschungsstrang kommt zu dem Ergebnis, dass die Polizei als Institution bzw. Organisation gesellschaftliche Rassismen aufgreift, diese „aber auch selbst hervorbringt“ (Bosch/Thurn 2022: 311; siehe auch Thompson 2018). In theoretischer Perspektive wird in Übereinstimmung mit der internationalen Diskussion darauf hingewiesen, dass die Funktion der Polizei schon von Beginn an in der Absicherung u. a. rassifizierter Eigentumsverteilungen sowie der wiederum Rassismen hervorbringenden Kontrolle von Mobilität gelegen habe (Thompson 2018; 2022). Einige neuere Arbeiten verknüpfen die Perspektive des institutionellen Rassismus zudem mit einer de- bzw. postkolonialen Perspektive (z. B. Melter 2017; Müller 2014). Im Zentrum der Argumentation steht die Annahme, dass der strukturelle Rassismus der Polizei insofern auf dem policing des Kolonialismus aufsitze, als einige der Praktiken zunächst dort entstanden und entwickelt worden sind (Müller 2014: 72; Fritsch/Kretschmann 2021).
Eng mit diesem Forschungsstrang verbunden sind polizeiabolitionistische Ansätze. In ihrer Emergenz sind sie eng verbunden mit einem internationalen Diskurs, der im Zuge der black lives matter-Bewegung Fahrt aufnahm. Sie tragen dem Umstand Rechnung, dass die Polizei für bestimmte Bevölkerungsgruppen Schutz und Sicherheit nur in unzureichendem Maße gewährleistet, bzw. teilweise sogar eine Gefahr für dieselben darstellt (Thompson 2020). Polizeiabolitionismus meint im akademischen Diskurs jedoch nur in den wenigsten Fällen die gänzliche Abschaffung der Polizei (so jedoch z. B. Loick 2018). Zumeist stehen Teil-Alternativen zur Polizei im Vordergrund (vgl. Legnaro/Kretschmann 2019). Dabei werden Forderungen aus Politik und Zivilgesellschaft aufgenommen. Sie umfassen etwa die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen, Kennzeichnungspflicht, die Ausweitung von Gesetzen zur Antidiskriminierung, ein Ende verdachtsunabhängiger Kontrollen sowie eine stärker sensibilisierende Ausbildungspraxis (Thompson 2018: 214).
6 Fazit und Ausblick
In diesem Beitrag haben wir den Forschungsstand zum Thema Rassismus in der Polizei erörtert und dabei drei Forschungsstränge ausgemacht – entlang erstens von Einstellungen, zweitens von Praktiken sowie drittens von Organisationen sowie im weiteren Kontext von Kriminalpolitik und Gesellschaft. Die Skizze des Forschungsstandes zeigt, dass dieser in der Polizei im deutschsprachigen Kontext noch klein, aber im Wachsen begriffen ist. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass er in erster Linie auf einer gesellschaftlich zunehmenden Sensibilisierung des Phänomens und erst in zweiter Linie auf Entwicklungen in den einschlägigen Forschungsfeldern beruht. In jüngster Zeit ist vor diesem Hintergrund erstmalig eine Konjunktur zu verzeichnen, die auf die Konsolidierung eines neuen Forschungsbereichs innerhalb der Polizei-, und abgeschwächt, in der Rassismus- und Diskriminierungsforschung, hinweist. Von einem konsolidierten Forschungsfeld ist jedoch aufgrund der Marginalität der kriminologischen Forschung insgesamt nicht auszugehen; hier besteht weiterhin Aufholbedarf. Merklich ist jedoch in diesem Zuge eine Annäherung jener kriminologischer Forschung, die sich mit Rassismus in der Polizei beschäftigt, und – dies teils über die Bande der Migrationsforschung gespielt – der Bewegungsforschung zu erkennen. Über den Themenkomplex Rassismus in der Polizei hinausgehend bestehen jedoch eine ganze Reihe weiterer Anknüpfungspunkte, so etwa im Bereich des Polizierens von Protest oder der Kriminalisierung von Aktivismus. Diese bilden bislang ein noch unausgeschöpftes Potenzial.
Über den Autor / die Autorin
Andrea Kretschmann (Professorin für Kultursoziologie) und Felix Fink (wissenschaftlicher Mitarbeiter) stellen an der Leuphana Universität Lüneburg einen Teil des Arbeitsbereichs Kultursoziologie. Sie sind Mitglieder der universitären Forschungsinitative „Kulturen des Konflikts“. Andrea Kretschmanns Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kultursoziologie und einer kulturtheoretisch verstandenen politischen Soziologie sowie Rechts- und Kriminalsoziologie. Das Thema Polizei interessiert diesbezüglich im weiteren gesellschaftlichen Kontext. Dies umfasst etwa den Umgang mit Versicherheitlichungen im Phänomenbereich, z. B. in Form der Prävention und einer Logik des Risikos, der Präemption und des Denkens in worst cases oder – all dies umfassend – in Form von Ausnahmezuständen. In thematischer Hinsicht interessiert aktuell das Verhältnis von Polizei und Zivilgesellschaft, darunter Protest. Felix Fink beschäftigt sich im Rahmen seiner Dissertation mit politischen Bekenntniskulturen der Moderne anhand von Märtyrerdiskursen in Literatur, Selbstzeugnissen und Öffentlichkeit. Zu seinen Forschungsthemen zählen außerdem die Polizei, online vernetzter Rechtsterrorismus sowie Männlichkeit und Gewalt.
Literatur
Abdul-Rahman, Laila/Espín Grau, Hannah/Klaus, Luise/Singelnstein, Tobias 2020: Rassismus und Diskriminierungserfahrungen im Kontext polizeilicher Gewaltausübung: Zweiter Zwischenbericht zum Forschungsprojekt „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt:innen“ (KviAPol).
Asmus, Hans-Joachim/Enke, Thomas 2016: Der Umgang der Polizei mit migrantischen Opfern. Eine qualitative Untersuchung. Springer VS.10.1007/978-3-658-10440-5
Assall, Moritz/Gericke, Carsten 2016: Zur Einhegung der Polizei. Rechtliche Interventionen gegen entgrenzte Kontrollpraktiken im öffentlichen Raum am Beispiel der Hamburger Gefahrengebiete. In: KJ 49(1), 61–71.10.5771/0023-4834-2016-1-61
Atali-Timmer, Fatoş/Fereidooni, Karim/Schroth, Kathrin 2022: Rassismuskritische Polizeiforschung – Eine Spurensuche. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 33–52.10.1007/978-3-658-37133-3_3
Barskanmaz, Cengiz 2019: Recht und Rassismus. Springer-Verlag.10.1007/978-3-662-59746-0
Behr, Rafael 2000: Funktion und Funktionalisierung von Schwarzen Schafen in der Polizei. In: Kriminologisches Journal 32(3), 219–229.
Behr, Rafael 2008: Cop Culture – Der Alltag des Gewaltmonopols. Männlichkeit, Handlungsmuster und Kultur der Polizei. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Behr, Rafael 2017: Diskriminierung durch Polizeibeamte. In: Scherr, Albert/El-Mafaalani, Aladin/Yüksel, Gökçen (Hrsg.): Handbuch Diskriminierung. Springer Fachmedien, 301–319.10.1007/978-3-658-10976-9_23
Behr, Rafael 2018: Rassismus und Diskriminierung im Polizeidienst. Die Karriere zweier „Reizworte“. In: SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis, 15(2), 57–66.
Behr, Rafael 2019: Verdacht und Vorurteil. Die polizeiliche Konstruktion der „gefährlichen Fremden“. In: Howe, Christiane/Ostermeier, Lars (Hg.): Polizei und Gesellschaft. Springer VS, 17–45.10.1007/978-3-658-22382-3_2
Belina, Bernd 2016: Der Alltag der Anderen. Racial Profiling in Deutschland? In: Dollinger, Bernd/Schmidt-Semisch, Henning (Hg.): Sicherer Alltag? Politiken und Mechanismen der Sicherheitskonstruktion im Alltag. Springer VS, 123–146.10.1007/978-3-658-07268-1_6
Belina, Bernd 2022: Verräumlichte Wahrnehmung. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 323–335.10.1007/978-3-658-37133-3_15
Bosch, Alex/Thurn, Roman 2022: Strukturell – Institutionell – Individuell – Dimensionen des polizeilichen Rassismus. Versuch einer Begriffsklärung. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 181–198.10.1007/978-3-658-37133-3_9
Böttger, Andreas/Lobermeier, Olaf/Plachta, Katarzyna 2014: Opfer rechtsextremer Gewalt. Springer VS.10.1007/978-3-531-93394-8
Bruce-Jones, Eddie 2015: German policing at the intersection: race, gender, migrant status and mental health. In: Race & Class 56, 36–49. 10.1177/0306396814556223
Bornewasser, Manfred 2009: Ethnische Vielfalt im eigenen Land. Eine nicht nur sprachliche Herausforderung im Innen- und Außenverhältnis der Polizei. In: Liebl, Karlhans (Hg.): Polizei und Fremde – Fremde in der Polizei. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 13–44.10.1007/978-3-531-91467-1_2
Cremer, Hendrik 2013: Das Verbot rassistischer Diskriminierung nach Art. 3 Abs. 3 GG. Ein Handlungsfeld für die anwaltliche Praxis am Beispiel von „Racial Profiling“. In: Anwaltsblatt 12, 896–899.
Derin, Benjamin/Singelnstein, Tobias 2022: Die Polizei. Helfer, Gegner, Staatsgewalt. Econ.
Eckert, Roland/Bornewasser, Manfred/Willems, Helmut 1996: Die Polizei im Umgang mit Fremden Problemlagen, Belastungssituationen und Übergriffe. In: Polizei-Führungsakademie (Hg.): Thema heute: Fremdenfeindlichkeit in der Polizei? Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie. Schmidt-Römhild, 2–166.
Eckert, Roland/Jungbauer, Johannes/Willems, Helmut 1998: Polizei und Fremde. Belastungssituationen und die Genese von Feindbildern und Übergriffen. In: Eckert, Roland (Hg.): Wiederkehr des „Volksgeistes“? Ethnizität, Konflikt und politische Bewältigung. Leske + Budrich, 215–228.10.1007/978-3-322-99666-4_7
ECRI, Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz 2007: Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 11. https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-11-oncombating-racism-and-racia/16808b5ade.
Egbert, Simon 2018: Predictive Policing und die soziotechnische Konstruktion ethnisch codierter Verdächtigkeit. In: Pfadenhauer, M./Poferl, A. (Hg.): Wissensrelationen. Beiträge und Debatten zum 2. Sektionskongress der Wissenssoziologie. Juventa, 653–663.
End, Markus 2019: Antiziganismus und Polizei. Zentralrat Deutscher Sinti und Roma.
Espín Grau, Hannah/Klaus, Luise 2022: Rassistische Diskriminierung im Kontext polizeilicher Gewaltanwendung. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 359–382.10.1007/978-3-658-37133-3_17
Groß, Eva/Clasen, Julia/Zick, Andreas 2022: Ursachen und Präventionsmöglichkeiten bei Vorurteilen und Diskriminierungen in der Polizei. Zur Relevanz des Syndroms der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit für die Analyse, Prävention und Intervention in Polizeiforschung und -arbeit. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 145–180.10.1007/978-3-658-37133-3_8
Fassin, Didier 2013: Enforcing Order. An Ethnography of Urban Policing. Polity.
Feltes, Thomas/Plank, Holger (Hg.) 2021a: Rassismus, Rechtsextremismus, Polizeigewalt. Beiträge für und über eine rechtschaffen(d)e, demokratische Bürgerpolizei. Lorei.
Feltes, Thomas/Plank, Holger 2021b: Auf dem Weg zu einer rechtschaffen(d)en, demokratischen Bürgerpolizei. Was kann und was muss getan werden, um Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei vorzubeugen? In: Feltes, Thomas/Plank, Holger (Hg.): Rassismus, Rechtsextremismus, Polizeigewalt. Beiträge für und über eine rechtschaffen(d)e, demokratische Bürgerpolizei. Lorei, 263–299.
Foucault, Michel 1976: Räderwerke des Überwachens und Strafens. Ein Gespräch mit J.-J. Brochier. In: Foucault, Michel (Hg.): Mikrophysik der Macht. Über Strafjustiz, Psychiatrie und Medizin. Merve, 31–47.
Fox, James C./Lundman, Richard J. 1974: Problems and Strategies in Gaining Research Access in Police Organisations. In: Criminology 12(1), 52–69.10.1111/j.1745-9125.1974.tb00620.x
FRA, European Union Agency for Fundamental Rights 2010a: European Union Minorities and Discrimination Survey – Main Results Report. European Union Agency for Fundamental Rights. https://fra.europa.eu/sites/default/files/frauploads/663fra-2011eumidisen.pdf.
FRA, European Union Agency for Fundamental Rights 2010b: Bericht der Reihe „Daten kurz gefasst“ – Polizeikontrollen und Minderheiten. https://fra.europa.eu/sites/default/files/frauploads/1132-EU-MIDIS-policeDE.pdf.
FRA, European Union Agency for Fundamental Rights 2017: Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Main results. https://fra.europa.eu/sites/default/files/frauploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-resultsen.pdf.
Fritsch, Katharina/Kretschmann, Andrea 2022: Politics of Exception. Criminalizing Activism in Western European Democracies. In: Weis, Vegh (Hg.): Activism tought the language of Criminality: Historical Perspectives in the Criminalization of Social and Political Engagement. Routledge.10.4324/9781003144229-3
Gesemann, Frank 2003: „Ist egal ob man Ausländer ist oder so – jeder Mensch braucht die Polizei.“ Die Polizei in der Wahrnehmung junger Migranten. In: Groenemeyer, Axel/Mansel, Jürgen (Hg.): Die Ethnisierung von Alltagskonflikten. Leske + Budrich, 203–228.10.1007/978-3-322-99668-8_9
Heitmeyer, Wilhelm/Müller, Joachim/Schröder, Helmut 1997: Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland. Suhrkamp.
Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport (HMdIS) (Hg.) 2020: Polizeiliche Alltagserfahrungen – Herausforderungen und Erfordernisse einer lernenden Organisation. Forschungsbericht 2020.
Herrnkind, Martin 2000: Personenkontrollen und Schleierfahndung. In: Kritische Justiz 33(2), 188–208.10.5771/0023-4834-2000-2-188
Herrnkind, Martin 2014: „Filzen Sie die üblichen Verdächtigen!“ oder: Racial Profiling in Deutschland. Polizei & Wissenschaft 15(3), 35–58.
Herrnkind, Martin 2021: Polizeirassismus in Deutschland: Kursorischer Versuch einer systematischen Bestandsaufnahme. In: Feltes, Thomas/Plank, Holger (Hg.): Rassismus, Rechtsextremismus, Polizeigewalt. Beiträge für und über eine rechtschaffen(d)e, demokratische Bürgerpolizei. Lorei, 85–100.
Herrnkind, Martin 2022: Gefahrenabwehr und Eigensicherung. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 295–320.10.1007/978-3-658-37133-3_14
Hunold, Daniela 2014: Polizei im Revier: Polizeiliche Handlungspraxis gegenüber Jugendlichen in der multiethnischen Stadt. Dissertation. Duncker & Humblot.
Hunold, Daniela/Dangelmaier, Tamara/Brauer, Eva 2021: Soziale Ordnung und Raum – Aspekte polizeilicher Raumkonstruktion. In: SozProb 32(1), 19–44.10.1007/s41059-020-00070-1
Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.) 2022a: Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS.10.1007/978-3-658-37133-3
Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias 2022b: Einführung. In: Dies. (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 1–14.10.1007/978-3-658-37133-3_1
Hunold, Daniela/Wegner, Maren 2020: Rassismus und Polizei. Zum Stand der Forschung. Aus Politik und Zeitgeschichte 70(42–44), 27–32.
infratest dimap 2020: Vertrauen in die Polizei. report München. https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/vertrauen-in-die-polizei/
Jaschke, Hans-Gerd 1997: Öffentliche Sicherheit im Kulturkonflikt. Zur Entwicklung der städtischen Schutzpolizei in der multikulturellen Gesellschaft. Campus.
Jobard, Fabien/Lévy, René 2013: Identitätskontrollen in Frankreich. Diskriminierung festgestellt, Reform ausgeschlossen. In: Bürgerrechte und Polizei 104, 29–37.
Jobard, Fabien/Lévy, René 2017: Polizei, Justiz und rassistische Diskriminierungen in Frankreich. In: Fereidooni, Karim/El, Meral (Hg.): Rassismuskritik und Widerstandsformen. Springer VS, 529–544.10.1007/978-3-658-14721-1_31
Karakayali, Juliane 2022: Kritische Rassismusforschung. Theorien, Konzepte, zentrale Befunde. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 15–32.10.1007/978-3-658-37133-3_2
Kemme, Stefanie/Essien, Iniobong/Stelter, Marleen 2020: Antimuslimische Einstellungen in der Polizei? In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 103(2), 129–149.10.1515/mks-2020-2048
Kempen, Aiko 2021: Auf dem rechten Weg? Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Europa Verlag.
Kollaborative Forschungsgruppe Racial Profiling (KFRP) 2019: Racial Profiling. Erfahrung, Wirkung, Widerstand. https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/racial-profiling.pdf.
Kopke, Christoph 2022: Rechtsextremismus in der Polizei – Skandale, Befunde und Mutmaßungen. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 127–143.10.1007/978-3-658-37133-3_7
Kretschmann, Andrea/Legnaro, Aldo 2019: Polizei und Gewalt. Sozialwissenschaftliche Lektüren eines untrennbaren Verhältnisses. In: juridikum 3, 373–383.10.33196/juridikum201903037301
Krott, Nora Rebekka/Krott, Eberhard/Zeitner, Ines 2018: Xenophobic attitudes in German police officers. In: International Journal of Police Science & Management 20(3), 174–184.10.1177/1461355718788373
Leitgöb-Guzy, Nathalie 2021: Forschungsbericht. Vertrauen in und Erfahrungen mit Polizei und Justiz unter Personen mit Migrationshintergrund. Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut.
Liebscher, Doris 2020: Clans statt Rasse – Modernisierung des Rassismus als Herausforderung für das Recht. Kritische Justiz 53(4), 529.10.5771/0023-4834-2020-4-529
Lindner, Marita 2001: Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Gewalt. Meinungen und Einstellungen von Auszubildenden der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen. Kovač.
Loick, Daniel 2018: Was ist Polizei-Kritik?. In: Ders. (Hg.): Kritik der Polizei. Campus.
Luff, Johannes/Gerum, Manfred 1995: Ausländer als Opfer von Straftaten. KFG Bayerisches Landeskriminalamt.
Melter, Claus 2017: Koloniale, nationalsozialistische und aktuelle rassistische Kontinuitäten in Gesetzgebung und der Polizei am Beispiel von Schwarzen Deutschen, Roma und Sinti. In: Fereidooni Karim/El, Meral (Hg.): Rassismuskritik und Widerstandsformen. Springer VS, 589–612.10.1007/978-3-658-14721-1_35
Miller, Joel/Gounev, Philip/Pap, András L./Wagman, Dani/Balogi, Anna/Bezlov, Tihomir et al. 2008: Racism and Police Stops. In: European Journal of Criminology 5(2), 161–191.10.1177/1477370807087641
Mletzko, Matthias/Weins, Cornelia 1999: Polizei und Fremdenfeindlichkeit. Ergebnisse einer Befragung in einer westdeutschen Polizeidirektion. In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 82(2), 77–93.10.1515/mks-1999-820204
Monjardet, Dominique 2005: Gibier de recherche, la police et le projet de connaître. In: Criminologie 38(2), 13–3710.7202/012660ar
Müller, Markus-Michael 2014: Polizieren als (post-)koloniale Praxis. Einsichten für eine kritische Polizeiforschung. Ein Beitrag zur Debatte um kritische Polizeiforschung. In: sub\urban (2), 71–76.10.36900/suburban.v2i2.137
Nohl, Arnd-Michael 2009: Ethnisierungserfahrungen Jugendlicher – Zur vergleichenden Rekonstruktion sozialer Probleme in der Einwanderungsgesellschaft. In: Liebl, Karlhans (Hg.): Polizei und Fremde – Fremde in der Polizei. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 69–87.10.1007/978-3-322-99668-8_3
Oberwittler, Dietrich/Schwarzenbach, Anina/Gerstner, Dominik 2014: Polizei und Jugendliche in multiethnischen Gesellschaften. Ergebnisse der Schulbefragung 2011 „Lebenslagen und Risiken von Jugendlichen“ in Köln und Mannheim. http://www.mpicc.de/shared/data/pdf/rib_47_oberwittler_ua.pdf.
Oberwittler, Dietrich 2016: Jugendliche und Polizei – Eine vergleichende Untersuchung zur Rolle verdachtsunabhängiger Personenkontrollen in französischen und deutschen Städten. In: RdJB 64(4), 414–427.10.5771/0034-1312-2016-4-414
Plümecke, Tino/Wilopo, Claudia S. 2019: Die Kontrolle der »Anderen«. In: Wa Baile, Mohamed/Dankwa, Serena Owosua/Naguib, Tarek/Purtschert, Patricia/Schilliger, Sarah (Hg.): Racial profiling. Struktureller Rassismus und antirassistischer Widerstand. Transcript, 139–154.10.14361/9783839441459-008
Püschel, Hannes 2022: Polizeilicher Umgang mit Opfern aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte. In: Hunold, Daniela/Singelnstein, Tobias (Hg.): Rassismus in der Polizei. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer VS, 405–422.10.1007/978-3-658-37133-3_19
Quent, Matthias/Geschke, Daniel/Peinelt, Eric (Hg.) 2014: Die haben uns nicht ernst genommen. Eine Studie zu Erfahrungen von Betroffenen rechter Gewalt mit der Polizei. ezra.
Reichertz, Jo 1990: „Meine Schweine erkenne ich am Gang“. Zur Typisierung typisierender Kriminalpolizisten. Kriminologisches Journal 22.
Reichertz, Jo 2003: Empirisch-wissenssoziologische Polizeiforschung in Deutschland. In: Lange, Hans-Jürgen (Hg.): Die Polizei der Gesellschaft. Zur Soziologie der Inneren Sicherheit. Leske und Budrich, 413–426.10.1007/978-3-663-09756-3_23
Salentin, Kurt 2008: Diskriminierungserfahrungen ethnischer Minderheiten in der Bundesrepublik. In: Groenemeyer, Axel/Wieseler, Silvia (Hg.): Soziologie sozialer Probleme und sozialer Kontrolle. Realitäten, Repräsentationen und Politik. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 515–526.10.1007/978-3-531-90879-3_27
Sauer, Martina 2006: Das Image der Polizei bei türkeistämmigen Migranten in Nordrhein-Westfalen – Ergebnisse einer repräsentativen Telefonbefragung, Zentrum für Türkeistudien.
Scherr, Albert/El-Mafaalani, Aladin/Yüksel, Gökçen (Hg.) 2017: Handbuch Diskriminierung. Springer Fachmedien.10.1007/978-3-658-10976-9
Schöne, Marschel/Herrnkind, Martin 2020: Sippenforschung und die Graugans Martina. In: Neue Kriminalpolitik 32(3), 379–384.
Schweer, Thomas/Strasser, Hermann 2003: Die Polizei – dein Freund und Helfer?! In: Groenemeyer, Axel/Mansel, Jürgen (Hg.): Die Ethnisierung von Alltagskonflikten. Leske + Budrich, 229–260.10.1007/978-3-322-99668-8_10Suche in Google Scholar
Schweer, Thomas/Strasser, Hermann 2008: Einblick. Cop Culture und Polizeikultur. In: Schweer, Thomas/Strasser, Hermann/Zdun, Steffen (Hg.): „Das da draußen ist ein Zoo, und wir sind die Dompteure“. Polizisten im Konflikt mit ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 11–38.10.1007/978-3-531-90962-2_1
Singelnstein, Tobias 2021: Rassismus in der Polizei. In: Singelnstein, Tobias/Ruch, Andreas (Hg.): Auf neuen Wegen. Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft aus interdisziplinärer Perspektive. Festschrift für Thomas Feltes zum 70. Geburtstag. Duncker & Humblot, 379–392.10.3790/978-3-428-55773-8
Strobl, Rainer 1998: Soziale Folgen der Opfererfahrungen ethnischer Minderheiten. Effekte von Interpretationsmustern, Bewertungen, Reaktionsformen und Erfahrungen mit Polizei und Justiz, dargestellt am Beispiel türkischer Männer und Frauen in Deutschland. Nomos.
Terkessidis, Mark 2004: Die Banalität des Rassismus. Migranten zweiter Generation entwickeln eine neue Perspektive. Transcript.10.1515/9783839402634
Thompson, Vanessa Eileen 2018: “There is no justice, there is just us!”. Ansätze zu einer postkolonial-feministischen Kritik der Polizei am Beispiel von Racial Profiling. In: Loick, Daniel (Hg.): Kritik der Polizei. Campus, 189–219.
Thompson, Vanessa Eileen 2020: Die Verunmöglichung von Atmen. Heinrich Böll Stiftung, Heimatkunde. https://heimatkunde.boell.de/de/2020/09/02/die-verunmoeglichung-vonatmen.
- Der besseren Lesbarkeit halber wird „Polizei“ hier in der Einzahl verwendet; die Polizei gibt es jedoch genau genommen nicht. ↩︎
- Siehe jedoch als Einzelfall bereits die Studie zum asymmetrische Opferumgang aus dem Jahr 1995 (Luff/Gerum). ↩︎
- Dies ist nur folgerichtig angesichts der gesellschaftlichen Stimmungslage in dieser Zeit: Zwar genießt die Polizei weiterhin ein großes Vertrauen der Bevölkerung, zugleich aber gehen rund 80 % der Befragten in einer repräsentativen Studie davon aus, dass die deutsche Polizei ein Problem mit Rassismus habe (infratest dimap 2020). ↩︎
Foto: Antirassistische Demonstration in Berlin, Dezember 2017 (cc-by-sa Montecruz Foto via Flickr)