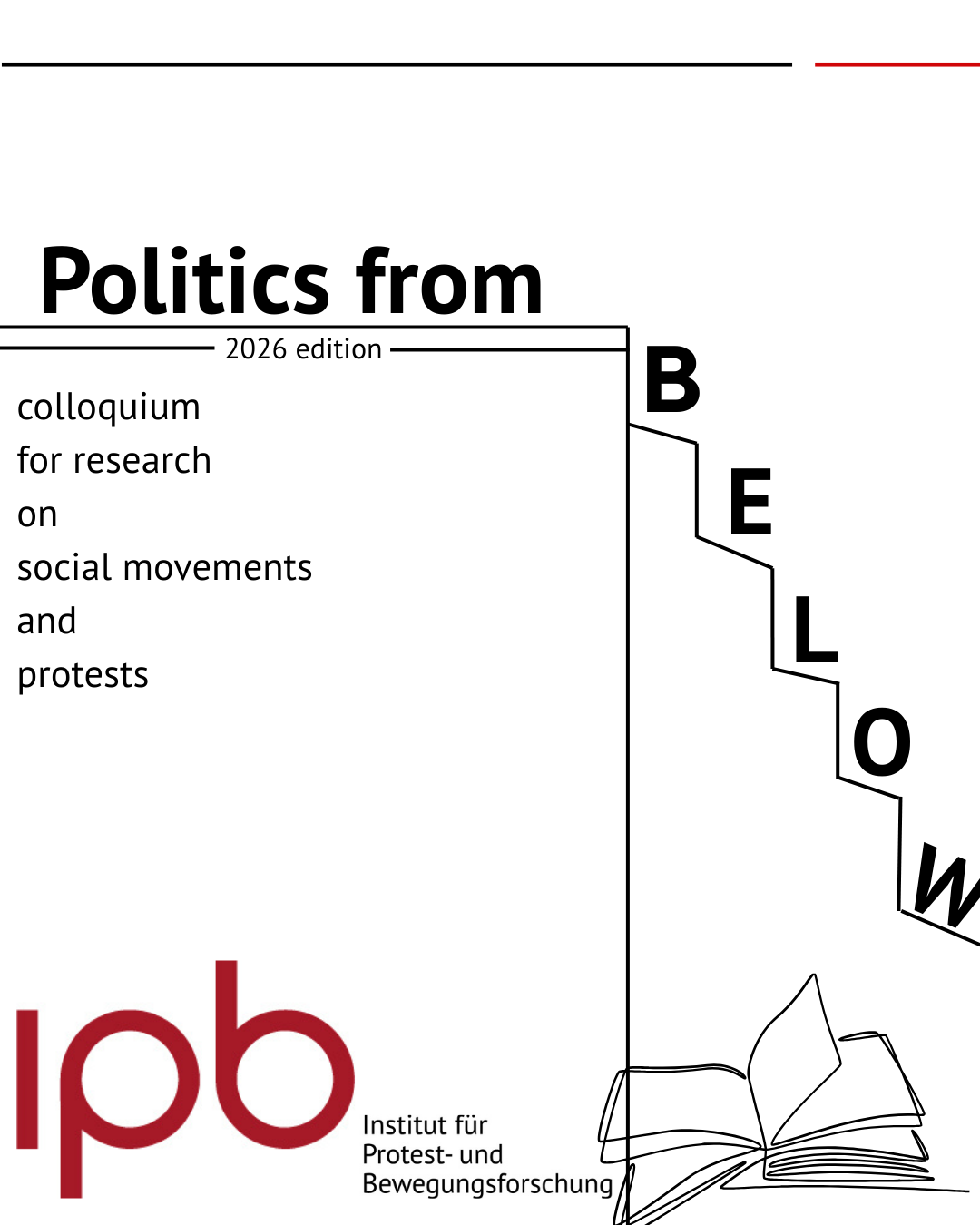Erleben wir eine Rückkehr autoritärer Konfliktlösungen?
von Peter Ullrich
zuerst erschienen in WZB-Mitteilungen 137 (pdf)
Die aktuell als Krisen beschriebenen Prozesse haben in den letzten beiden Jahren weltweit Millionen Menschen zu Protesten mobilisiert: die Immobilien-, Banken- und Staatsschuldenkrise und deren Folgen, aber auch die Umweltproblematik, die meist in der Semantik einer Dauerkrise beschrieben wird. Das Thema soziale Bewegungen und Protest ist in den Medien präsent wie nie. Diese haben in der Bundesrepublik mit den „Wut-“ und „Mutbürgern“ auch neue Labels geschaffen, unter denen über die verschiedenen Anliegen und Erscheinungsformen von Protest berichtet wurde.
Ein Moment, das die zum Teil recht heterogenen Anliegen der Proteste tatsächlich vereint, ist die Krise der politischen Repräsentation. Die postdemokratischen Verhältnisse, wie sie der britische Sozialwissenschaftler Colin Crouch nennt, kann man als formales Funktionieren der repräsentativ-demokratischen Regierungsformen bei gleichzeitiger Entleerung ihres politischen Gehalts und ihrer regulierenden Wirkung beschreiben. Sie rufen offensichtlich Entfremdung und Verbitterung hervor. Zu sehen, dass die Autoindustrie, die Banken oder schlicht „die Märkte“ die aus Technokratensicht notwendigen Milliardenhilfen in kürzester Zeit erhalten können, ist vielen Menschen kaum vermittelbar, wenn sich zeitgleich ihre soziale Situation immens verschärft – zurzeit besonders wahrnehmbar als steigende Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und andere Armutsfolgen in den Ländern Südeuropas.
Auf zwei Ebenen werden Tendenzen autoritären Re(a)gierens deutlich, die zum Teil aus der Verunsicherung durch die Krise herrühren und die Politik wie auch die Wissenschaft herausfordern: erstens im politischen Umgang mit den Krisen selbst und zweitens im Umgang der Sicherheitsorgane mit den auftretenden Krisenprotesten.
Krisenpolitik
Der politische Prozess gerät in Zeiten hektischer Krisenreaktionen verstärkt unter Druck. Mehrfach wurde beispielsweise die Bundesregierung wegen Missachtung der parlamentarischen Rechte vom Verfassungsgericht gerügt, weil Rettungspakete im Eilverfahren oder unter Umgehung des Parlaments verhandelt wurden. Aktuell geht die Regierungsmehrheit mit dem Fiskalpakt und dem Euro-Rettungsschirm ESM sogar das Risiko ein, möglicherweise nicht verfassungskonforme internationale Verträge abzuschließen. Die Vorlage hat sechs (!) Verfassungsbeschwerden und mehrere Organklagen ausgelöst. Brisant ist besonders die Tatsache, dass ihre völkerrechtlich verbindliche Ratifizierung auch dann nicht mehr rückgängig zu machen wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht nachträglich die Verfassungsmäßigkeit verneint.
Die damit verbundenen Austeritätsprogramme (Sparauflagen) untergraben die Souveränität der Empfängerländer, bedeuten für die Bevölkerungen zusätzlich zu den direkten Krisenfolgen harte soziale Einschnitte und stimulieren Protest.
Damit sich Unzufriedenheit jedoch tatsächlich als Protest artikuliert, müssen mehrere Bedingungen zusammenkommen. Zu den wichtigsten förderlichen Faktoren gehört derzeit beispielsweise das Vorhandensein erfolgreicher Vorbilder und attraktiver neuer Protestrepertoires wie Platzbesetzungen aus verschiedenen Mobilisierungen in anderen Ländern sowie eine verhältnismäßig aufgeschlossene Presseberichterstattung. Doch die neue Attraktivität der politischen Form des Protests resultiert, wie die Beispiele zeigen, zumindest zum Teil auch aus dem Image- und Bedeutungsverlust der konventionellen (repräsentativ-demokratischen) Beteiligungsformen. Dieses Moment haben die Krisenproteste auch mit den Protesten gegen Atommülltransporte oder den Bahnhofsumbau in Stuttgart gemein.
Protest und Bürgerrechte
Für demokratische Systeme ist der Umgang mit sogenannter unkonventioneller politischer Beteiligung (die, wie die Rede der „Bewegungsgesellschaft“ zeigt, de facto längst konventionell geworden ist) und die Überführung solcher Beteiligungsformen in politische Entscheidungen zu einem Prüfstein ihres demokratischen Inhalts geworden. Doch auch hier werden autoritäre Krisenreaktionen spürbar, die eine Herausforderung für die Demokratie darstellen.
Jüngstes besorgniserregendes Beispiel waren die Proteste gegen die Sparpolitik und insbesondere die Europäische Zentralbank in Frankfurt Mitte Mai 2012. Das Konzept zivilen Ungehorsams der Protestierenden unter dem medienwirksamen Titel „Blockupy“ war weitreichend, umfasste etwa das Ziel der körperlichen Blockade der Europäischen Zentralbank für einen Tag, unterlag aber einem strikten und am Ende sehr erfolgreichen Aktionskonsens der Zurückhaltung und Deeskalation. Die behördlichen Reaktionen darauf waren jedoch von ungeahnter Härte und versetzten Frankfurt in eine Art Ausnahmezustand – der paradoxerweise dazu führte, dass eher die Polizei als die Protestierenden die Frankfurter City blockierte. Zum präventiv-repressiven Repertoire gehörten „schier orgiastische Demonstrationsverbote“, wie die Süddeutsche Zeitung schrieb. Sogar Versammlungen für das Recht auf Demonstrationsfreiheit und eine lang geplante Gedenkveranstaltung der Jusos zur Erinnerung an NS-Opfer waren verboten worden.
Mehreren hundert Aktivistinnen und Aktivisten wurde schlicht der Zugang nach Frankfurt verweigert. Sie wurden stundenlang in Bussen festgehalten und abgefilmt, dann zurückgeschickt oder an entfernten Orten ausgesetzt. Hunderte unverhältnismäßige Aufenthaltsverbote, die die Frankfurter Behörden vor dem Protest verschickt hatten, mussten gerichtlich gestoppt werden. Die angeführten Begründungen waren in der Regel vage Vermutungen – und nicht die dafür rechtlich erforderlichen tatsächlichen Anhaltspunkte für zu erwartende Straftaten. Zum politischen Symbol wurden dabei die Verbotsverfügungen, die ausschließlich mit dem Schlagwort „Kapitalismuskritik“ begründet wurden.
In diesem sicherheitsstaatlichen Vorgehen, das grundgesetzlich garantierte Rechte teilweise außer Kraft zu setzen schien, traten jedoch langfristigere Entwicklungen zutage, mit denen sich die Forschung zum Protest-Policing, also dem polizeilichen Umgang mit Protest, befasst. Schon angesichts der teilweise exzessiven Gewalteskalationen bei Gipfelprotesten in Seattle (1999) oder Genua (2001) äußerten Protestforscher wie Donatella Della Porta die Befürchtung, dass sich eine autoritär-repressive Wende im Protest-Policing abzuzeichnen beginnt. Dabei war in den meisten westlichen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten eine Schwerpunktverschiebung innerhalb der Polizeiarbeit von Repression hin zu Prävention und Risikomanagement zu beobachten. Dem entsprach auch ein veränderter Umgang mit Protest.
Seit den 1960er Jahren waren ein zunehmendes Maß an Toleranz gegenüber Protestierenden sowie eine Abnahme des Einsatzes eskalierender Strategien zu beobachten. Es kam zu einer Zivilisierung und Pazifizierung des Protest-Policing. Der polizeiliche Respekt für demokratische Rechte war gestiegen, das war der Tenor der Forschung. Das ging bis hin zur Akzeptanz geringfügiger Gesetzesübertretungen, wenn dies half, die Gesamtsituation zu befrieden und Unbeteiligte zu schützen. Die Forschung bezeichnet dies als Wandlung vom „legalistischen“ zum „pragmatischen“ Einsatzstil.
Demgegenüber steht aber eine zunehmende Konzentration auf präventives Agieren durch Informationsgenerierung, Kommunikations- oder Konsensverfahren und andere taming-Strategien, was der Polizeiforscher Martin Winter als „deeskalative Stärke (im Gegensatz zur überwundenen eskalierenden Stärke) bezeichnet. Dabei verschwimmen jedoch durch den gewaltprophylaktischen Druck durch Vorkontrollen, Armierung, extensive Videoaufnahmen, einschließende Begleitung und andere Maßnahmen die Grenzen zwischen Prävention und Repression. Unsere Forschung zur Videoüberwachung von Demonstrationen hat gezeigt, dass solche Maßnahmen bei Teilnehmenden zumindest zwei grundsätzliche Effekte zeitigen: einerseits Verunsicherung und Abschreckung von der Teilnahme an politischem Protest und andererseits Gefühle von Ausgrenzung und Stigmatisierung, die das Konflikt- und Aggressionspotenzial eher anstacheln als eindämmen.
Die Umgangsweisen mit Protest jeder Art sind aber nicht einheitlich. Vielmehr sind die behördlichen Strategien selektiv und unterscheiden sich in Abhängigkeit von den betroffenen sozialen Gruppen. Wichtig für polizeiliche Strategieentscheidungen sind Kategorisierungs- und Verdachtsbildungsprozesse; die berufliche Kultur der Polizei ist eher pragmatisch und antitheoretisch geprägt und wendet vorrangig automatisierte Standard-Routinen an. Martin Winter hat gezeigt, dass die deutsche Polizei zu einer „binäre[n] Grundstruktur in der Protestdiagnose“ neigt und damit einfach unterscheidet zwischen Protest, der aus ihrer Sicht legitim ist oder illegitim. Dabei wird zwischen Zielen und Mitteln kaum
differenziert. Die Einordnung scheint oft vom Grad des politischen Antagonismus anstatt von strafrechtsrelevanten Tatbeständen abhängig zu sein.
Die Zuspitzung politischer Widersprüche in der Krise erweist sich so als mögliches Einfallstor für die Einschränkung von Bürgerrechten, die seit den Anschlägen des 11. September ohnehin unter Druck stehen. Doch auch dagegen regte sich in den vergangenen Jahren Protest. Zum ersten Mal seit der Bewegung gegen die Volkszählung in den 1980er Jahren gibt es mit den jährlichen Freiheit-statt-Angst-Demonstrationen wieder eine Bewegung gegen Überwachung und für Freiheits- und Bürgerrechte. Mit der Piratenpartei beginnen sich diese Forderungen nun auch im parlamentarischen Rahmen zu institutionalisieren. Doch das Monitoring des Verhältnisses von Polizei und Protest beschränkt sich derzeit im Wesentlichen auf die Arbeit von Bürgerrechtsorganisationen wie dem „Komitee für Grundrechte und Demokratie“. Sowohl die Bewegungs-Soziologie als auch die Polizei-Soziologie in Deutschland (beides ohnehin eher Orchideen unter den Bindestrich-Soziologien) haben sich in der Vergangenheit wenig für diese Themen interessiert. Angesichts der schwachen universitären Institutionalisierung der Protestforschung kann man nur vage auf eine zukünftig größere Aktivität hoffen, denn der staatliche Umgang mit Protest und die Zukunft der Bürgerrechte bleiben „mit Sicherheit“ ganz oben auf der politischen Agenda.
Literatur
Della Porta, Donatella/Reiter, Herbert (Eds.): Policing Protest. The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis: University of Minnesota Press 1998.
Fernandez, Luis A.: Policing Dissent: Social Control and the Anti-Globalization Movement. Critical Issues in Crime and Society. Piscataway: Rutgers University Press 2008.
Heßdörfer, Florian/Pabst, Andrea/Ullrich, Peter (Eds.): Prevent and Tame. Protest under (Self-)Control. Berlin: Dietz 2010. (pdf)
Ullrich, Peter: Gesundheitsdiskurse und Sozialkritik – Videoüberwachung von Demonstrationen. Zwei Studien zur gegenwärtigen Regierung von sozialen Bewegungen und Protest. Wissenschaftliche Texte des DJI. München: Deutsches Jugendinstitut 2011. (pdf)
Winter, Martin: „Police Philosophy and Protest Policing in the Federal Republic of Germany, 1960-1990“. In: Della Porta, Donatella/Reiter, Herbert: Policing Protest, Minneapolis: University of Minnesota Press 1998, S. 188-212.
Foto: Polizeieinsatz in Madrid gegen die Umzingelung des Kongresses am 25. September 2012 (Juan Plaza, cc)