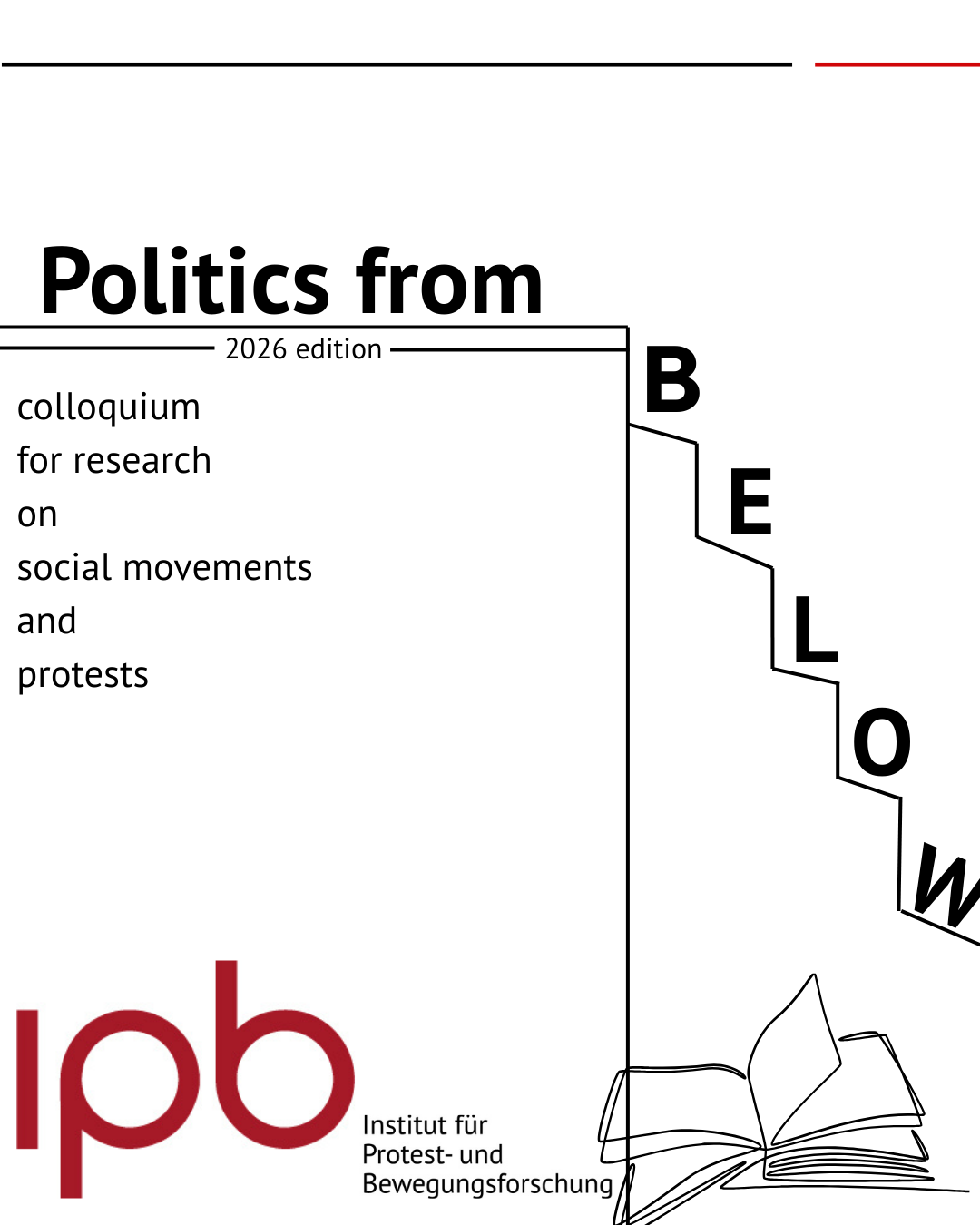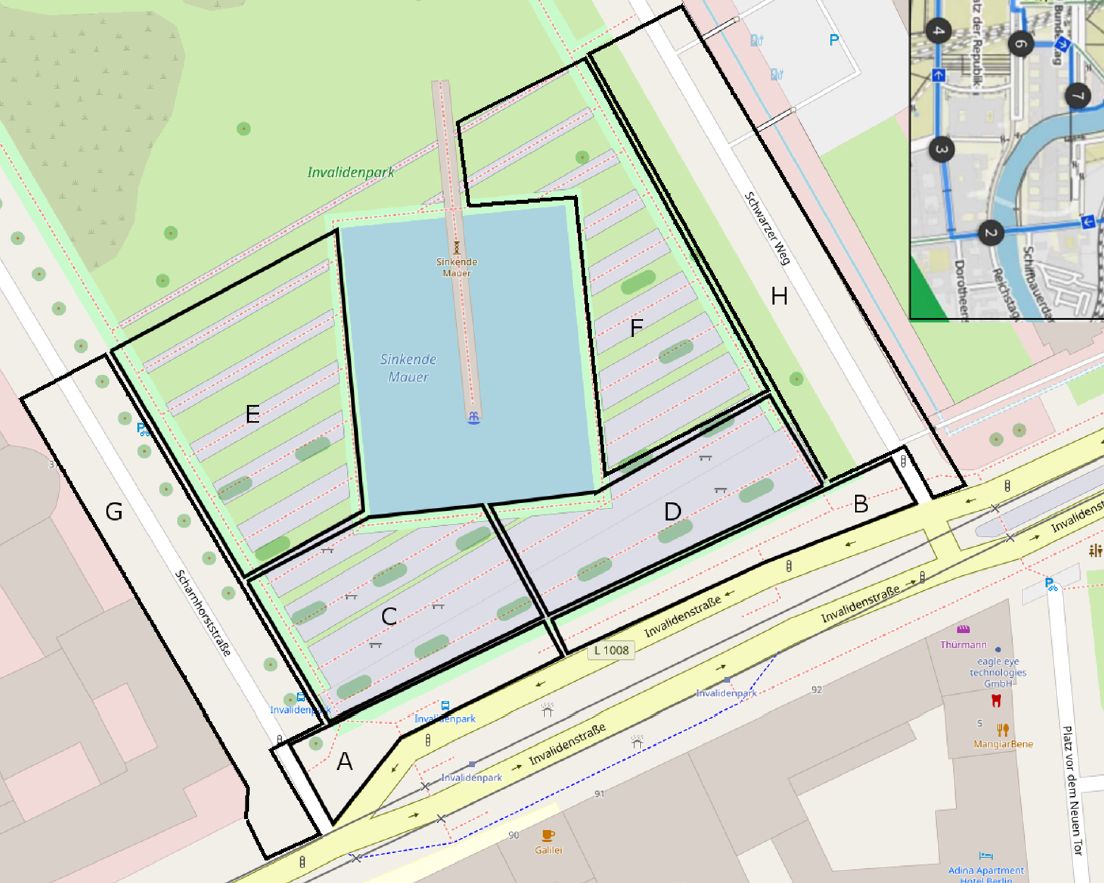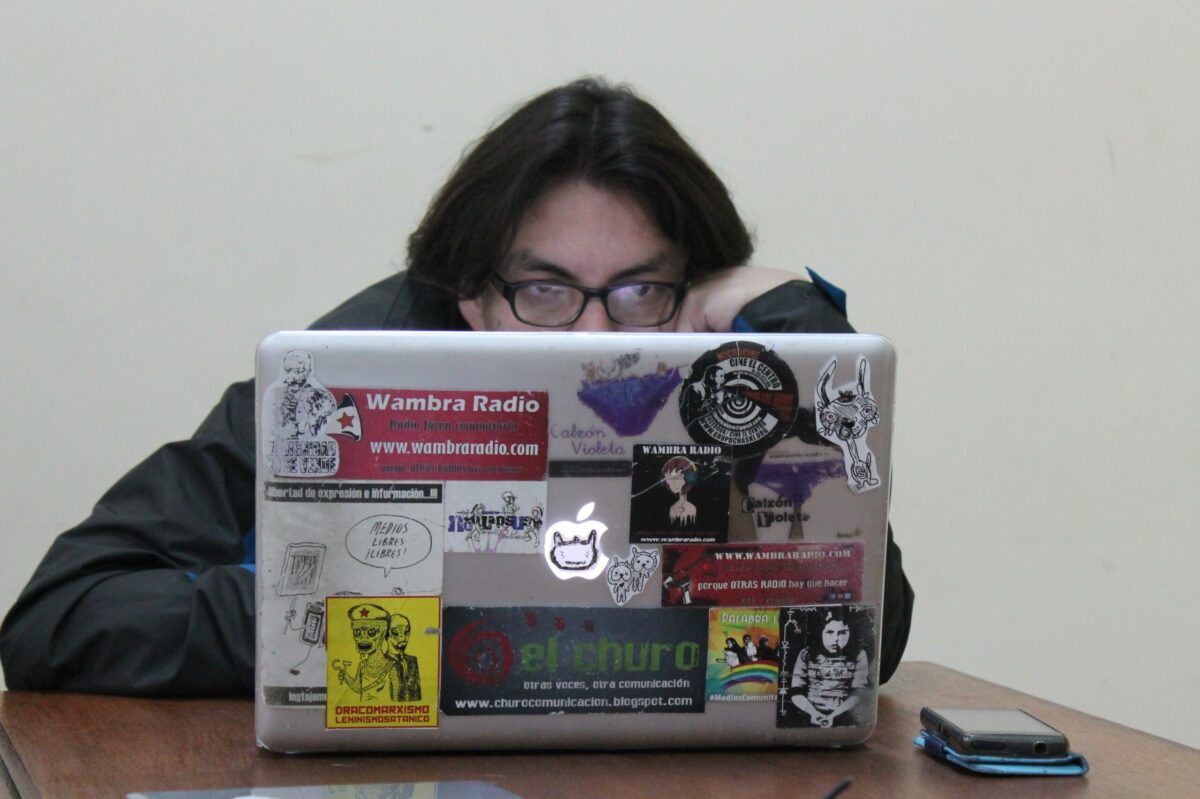Seit 2018 schreiben Autor*innen des ipb in einer eigenen Rubrik des Forschungsjournals Soziale Bewegungen: “ipb beobachtet”. Die Rubrik schafft einen Ort für pointierte aktuelle Beobachtungen und Beiträge zu laufenden Forschungsdebatten und gibt dabei Einblick in die vielfältige Forschung unter dem Dach des ipb.
Zu den bisher erschienenen Beiträge, die alle auch auf unserem Blog zu lesen sind, geht es hier.
Der folgende Text von Tareq Sydiq erschien unter dem Titel “Wissensproduktion zum Iran im Kontext der Proteste 2022: Ein Dilemma der Protestforschung” im Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 37, Heft 4.
1 Einleitung
Die Protestforschung ist gefragt. Angesichts medial stark rezipierter Protestbewegungen, ob in Deutschland bei den Protesten gegen Rechtsextremismus oder den Protesten der Bauernschaft Anfang 2024, international wirksamen Protesten beispielsweise gegen die PiS-Regierung in Polen oder die Modi-Regierung in Indien, ist auch die Protestforschung immer wieder wichtiger Anknüpfungspunkt für Einordnungen und Einschätzungen. Für die Protestforscher*innen selbst wirft dies gleichzeitig beträchtliche Dilemmata auf, die mit einer solchen Rolle in laufenden Protestbewegungen einhergehen.
Dieser Beitrag nimmt die Wissensproduktion und Wissenschaftskommunikation zum Iran im Kontext der jüngsten Protestwelle, der „Jin, Jiyan, Azadi“-Proteste 2022 nach dem Tod Jina Mahsa Aminis im Polizeigewahrsam in den Blick. In einem ersten Abschnitt soll es um die Rolle von Iran-Expertise in der Medienberichterstattung gehen und die Frage, wie insbesondere Protestforschung hierbei in Deutschland rezipiert wurde. Der zweite Teil widmet sich der Frage, welche ethischen und moralischen Fragen sich für die individuelle Protestforscher*in ergeben. Anschließend werdend daraus Fragen für die Rolle von Protestforschung in der Berichterstattung über aktuelle Protestbewegungen im Allgemeinen abgeleitet.
2 Expertise zu Iran im Allgemeinen und den „Jin, Jiyan, Azadi“-Protesten 2022 im Besonderen
Die deutsche Protestforschung ist traditionell besonders an Protesten in demokratischen Industrieländern interessiert. Zwar verändert sich dies seit einigen Jahren, und die Proteste in Nordafrika und Westasien haben seit 2010 eine heterogene Forschungslandschaft hervorgebracht, die sich mit sozialen Umbrüchen und Protestbewegungen in autokratischen Regimen in dieser Regierung befasst (siehe Bayat, 2020; Kamel/Huber 2015; Levine 2013; Lynch 2024; Ouaissa et al 2021). Wissensproduktion zu Protesten in den Ländern des sogenannten „Global Südens“ bleibt dennoch häufig benachbarten Disziplinen, etwa der Friedens- und Konfliktforschung – dort vor allem als gesellschaftlicher Konflikt in Abgrenzung zum militärischen Konflikt – oder den zahlreichen Regionalwissenschaften – dort als Spielart der historischen und politischen Traditionslinien – vorbehalten. Dies merkt man auch im Kontext des Irans: Protestforschung findet hier traditionell in der Iranistik oder den Nah- und Mitteloststudien, weniger innerhalb der Protestforschung statt. Nun ist dies auf den ersten Blick belanglos, solange eine Protestforschung überhaupt stattfindet. Der inhaltliche und theoretische Referenzrahmen prägt aber die Herangehensweise. So finden sich wesentlich mehr Studien zur Rolle der Religion und von Sanktionen für das Protestgeschehen als beispielsweise zu den Strategien und Taktiken der Protestierenden im Iran. Wenn die Protestforschung zu einer bestimmten Thematik nicht sichtbar ist, sind wenig überraschend ihre Fragen ebenfalls unterrepräsentiert – und Protest tendenziell als Funktion eines übergeordneten sozio-politischen Zusammenhangs (Handlungsfähigkeit des Staates, Wahlen, Ungleichheit, Konflikt) anstatt eines sozialen Phänomens für sich erfasst.
Im Kontext der Proteste, die September 2022 im Iran begannen, wurde diese unterschiedliche Herangehensweise deutlich. Innerhalb kurzer Zeit wurde „Protest im Iran“ von einem relativen Nischenthema zu einem medial dominierenden Thema. Damit wurden auch Stimmen aus der Wissenschaft stark nachfragt, da diese angesichts restriktiver Auflagen für Journalist*innen im Iran eine Informationslücke schließen und gleichzeitig aus einer jahrelangen wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Land heraus über Beobachtungen hinausgehende Einschätzungen treffen konnten. Obwohl in der deutschen Berichterstattung sehr heterogene „Iran-Expert*innen“ zu Wort kamen (in einer Stichprobe digitaler Medien zwischen dem 15.9.2022 und dem 16.11.2022 waren es 23 Personen, die insgesamt 44 Mal als „Iran-Expert*in“ zu Wort kamen), dominierten Stimmen aus den Internationalen Beziehungen. Expert*innen aus diesem Bereich waren fünfmal so häufig vertreten wie Expert*innen aus den Islam- und Regionalwissenschaften, die Protestforschung war so gut wie nicht vertreten.
Das beeinflusste auch die Deutungsmuster. Beispielhaft lässt sich an der sogenannten Deprivationstheorie illustrieren: In der Protestforschung wird die Rolle von Prekarisierung für Protest kontrovers diskutiert. Zwar kann Armut durchaus Unzufriedenheit produzieren und die Legitimität des politischen Systems infrage stellen (Bush 2010), aber verschiedene Forscher*innen haben die Rolle von Erwartungshaltungen (Davies 1962) und Wahrnehmungen (Power 2018) in diesem Prozess hervorgehoben: Deprivation alleine erklärt keinen Protest, sondern vielmehr die soziale Konstruktion von politischen Anliegen (Buechler 1993: 222), die aus dieser hervorgehen kann. Gleichzeitig zeigten zahlreiche Untersuchungen, dass der Zugang zu Ressourcen politisches Engagement begünstigt (Brady et al. 1995; Verba et al. 1993), mithin Deprivation für erfolgreichen Protest hinderlich sein kann – je nachdem, wie stark sie zivilgesellschaftliche Akteure betrifft.
Dessen ungeachtet hielt sich in der öffentlichen Debatte zu den Protesten 2022 hartnäckig die Ansicht, dass Sanktionen und damit einhergehende wirtschaftliche Probleme Protest begünstigen. In einer Lesart, die Staaten als zentrale Analyseeinheit fasst und den Blick auf deren Stärke und Schwäche richtet, mag dies schlüssig sein. Denn die Sanktionen schwächen unweigerlich den iranischen Staat, reduzieren seine Wirtschaftskraft und reduzieren seine Handlungsspielräume, in der Außenpolitik ebenso wie in der Sozialpolitik. Aus diesen reduzierten Kapazitäten des Staates lassen sich aber nur schwer Aussagen über den Erfolg von Protestbewegungen herstellen. Erklärungsansätze innerhalb der Protest- und Revolutionsforschung nehmen hierzu vielmehr Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie Erwartungshaltungen in den Blick. Mit Bezug auf den Effekt von Sanktionen lässt sich also durchaus zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen kommen – je nachdem, ob der Ausgangspunkt sich in einer stärker Staats-zentrierten oder einer stärker Gesellschafts-zentrierten Disziplin bewegt.
Dass die mediale Berichterstattung dermaßen ausfiel, ist nur nachvollziehbar. Denn Iran-Expertise heißt häufig: außenpolitische Expertise, in welcher geostrategische Interessen und staatszentrierte Perspektiven überwiegen (Lacher 2003; Baumann/Stengel 2014). Diese Expertise ist zudem viel stärker an eine wissenschaftliche fundierte Politikberatung angekoppelt. Während die Protestforschung traditionell an Universitäten und forschungsnahen Einrichtungen angebunden ist, findet außenpolitische Forschung auch in namhaften Denkfabriken und ähnlichen Einrichtungen statt, die politische Entscheidungsfindungsprozesse im Blick haben, oftmals eng mit diesen verzahnt sind und die in politischen Kreisen gängige Sprache beherrschen. In der Folge ist der Weg von Beobachtungen zu Einschätzungen und zu Handlungsempfehlungen hier tendenziell kürzer als in der Protestforschung, die aus ihrem Kerngeschäft heraus selten Handlungsempfehlungen ableitet und dies in einer dynamischen Ad-hoc-Situation mit teils widersprüchlichen Beobachtungen erst recht nicht leisten mag.
Schließlich wurde Iran-Expertise selbst als Politikum behandelt. Die Unabhängigkeit von Expert*innenstimmen wird von Aktivist*innen und Medien regelmäßig infrage gestellt – ungeachtet ihrer tatsächlichen Expertise. Dass Denkfabriken wie die SWP oder die DGAP häufig direkt vom Staat finanziert werden oder Parteien nahestehen, wie im Falle der Konrad Adenauer Stiftung (KAS) und der Friedrich Ebert Stiftung (FES), wird hier beispielsweise angeführt. Über die Validität der Erkenntnisse und angewandten Methoden sagt die Finanzierung allerdings wenig aus. Denn diese gibt lediglich Hinweise auf möglicherweise mit besonderem Interesse verfolgte Fragestellungen, nicht aber auf die Qualität der Vorgehensweise, mit der diese Fragen beantwortet werden. Letzteres ist aber entscheidend, wenn es um die Einschätzung von Expertise geht. Ebenso wurde die Positionalität der Expert*innenstimmen als Beleg für existierende oder fehlende Expertise herangezogen. Ob jemand iranische Wurzeln hat, konnte so durchaus die Akzeptanz dieser Expertise beeinflussen, unabhängig von der Sachlage. Dabei vermischen sich hier politische Forderungen nach Repräsentation mit inhaltlicher Kritik auf teilweise unzulässige Weise. Denn biografische Verbindungen alleine sind weder ein Garant für Sprachkenntnisse noch für ein Verständnis sozio-politischer Dynamiken vor Ort.
3 Dilemmata der Protestforschung zu aktuellen Protesten
In diesem Spannungsfeld ergaben sich Ende 2022 vier Dilemmata, die sich auf die allgemeinere Protestforschung übertragen lassen.
3.1 Der Umgang mit unübersichtlichen Protestlagen
Als die Proteste im Iran ab Mitte September 2022 an Fahrt aufnahmen, nahm auch das internationale mediale Interesse stark zu. Damit einher ging ein Bedarf nach Einschätzungen und Einordnungen der Lage vor Ort. Dieser Bedarf verhielt sich aber nicht proportional zur tatsächlich vorliegenden Informationslage, denn eine systematische Einschätzung hinkt den Entwicklungen meist hinterher. Im Kontext des Iran waren zentrale Fragestellungen, wie viele Menschen genau protestierten, welche sozialen Gruppen sie repräsentierten, und wie erfolgreich ihr Protest sein könnte.
Diese Fragen ließen sich allesamt nicht sachlich beantworten, da es zum Zeitpunkt der Proteste keine verlässlichen Daten gab. Erst im Nachhinein ließen sich viele der für die Beantwortung zentralen Informationen rekonstruieren, was aber dem Informationsbedarf nicht gerecht wurde. Expert*innen fanden also verschiedene Annäherungen. Ende Oktober veröffentlichte die britische Tageszeitung The Guardian eine detaillierte Aufzählung aller bekannt gewordener Proteste der vorherigen fünf Wochen (de Hoog/Morresi 2022). Damit ließ sich abschätzen, wie geographisch heterogen die Proteste waren und wie viele Protestereignisse es gegeben hatte. Aus dieser Übersicht ließ sich nun ableiten, dass die Proteste in traditionell von ethnischen Minderheiten bewohnten Provinzen und in sozio-ökonomisch heterogenen Nachbarschaften stattgefunden hatten. Es ist plausibel, dass hier auch die entsprechenden ethnischen und ökonomischen Gruppen demonstrierten. Bewiesen ist dies aber nicht, denn natürlich könnten beispielsweise Menschen aus anderen Nachbarschaften zum Protest angereist sein. Der Ort sagt noch wenig über die Teilnehmenden aus. Ebenso sagt die große Anzahl von Protestereignissen wenig über die tatsächliche Teilnehmerzahl aus – gerade bei eher kleinen, dezentral organisierten Protesten, die vermehrt über soziale Medien dokumentiert wurden. Ob letztlich Zehntausende oder Millionen auf die Straße gingen, lässt sich daraus schwer ableiten, macht bei der politischen Bewertung aber einen erheblichen Unterschied. Ein weiteres Beispiel ist der Revolutionsbegriff, den Aktivist*innen für die Protestbewegung verwendeten und damit den Anspruch auf eine Revolution formulierten. Diesen politischen Begriff als analytische Kategorie zu verwenden, hätte aber einem Ausgang der Proteste vorgegriffen: Ob wirklich ein Umsturz mit entsprechender politischer Veränderung erfolgen würde, war im Oktober 2022 schlicht nicht einschätzbar.
Für Protestforschung heißt dies in unübersichtlichen Protestlagen, vor allem auf die Methoden der Protestforschung aufmerksam zu machen und daraus Unzulänglichkeiten in der Einschätzung zu begründen. Einer breiten Öffentlichkeit sind Protestbefragungen, Teilnehmerzählungen und die Erfolgskonditionen für Protest nicht vertraut. Immer wieder auf Wissenslücken hinzuweisen, und bei Einschätzungen die Grundlage transparent zu machen (eigene Kontakte vor Ort, Auswertung von Bildmaterial, semi-offizielle Statistiken), kann dabei helfen, hier Halb- von Nichtwissen zu trennen.
3.2 Hochgradig politisierte Debatten
Die Kommunikation einer solchen Uneindeutigkeit wird dadurch erschwert, dass die Debatten selbst hochgradig politisiert sind (Hermann 2022; Zamirirad 2022; Zekri 2022). Medial werden nicht alleine Wissensproduktionen diskutiert, sondern eben auch konkurrierende Deutungskonflikte über Erfolgsaussichten und den Umgang mit Protestbewegungen ausgetragen. Und hier stehen Wissenschaftler*innen eben auch Aktivist*innen und Politiker*innen gegenüber, die teils ebenfalls an Wissensproduktion für sich, teils aber eher an einer politischen Zielen untergeordneten Wissensproduktion interessiert sind.
Wenig überraschend sprachen sich Politiker*innen, die bereits für ein humanitäres Asylsystem kämpfen, im Kontext der Proteste ebenfalls für einen besseren Umgang mit iranischen Asylbewerber*innen aus (Bünger 2023). Wer wiederum für eine aggressivere Außenpolitik gegenüber Autokratien im Allgemeinen und dem Iran im Besonderen war, fand in den iranischen Protesten jetzt ein neues Argument, die bereits existierende Position zu stärken (Hardt 2023). In diesem politischen Spannungsfeld spielten die Tatsachen durchaus eine Rolle, sie wurden aber in präexistierende Deutungsmuster eingespannt.
Für die Einbindung von Protestforschung in den öffentlichen Diskurs heißt dies, dass ihre wissenschaftliche Qualität teils im öffentlichen Diskurs eine geringere Rolle spielt als die Verwertbarkeit für politische Grabenkämpfe. Das ist ebenfalls keine neue Dynamik. Die Diskussion um Expertise im Kontext der Covid-19 Pandemie nahm stellenweise ähnliche Züge an (Borgers 2020; Kastilan 2020). Wissenschaftliche Qualitätskriterien lassen sich in der Öffentlichkeit schließlich nur begrenzt nachvollziehen. Für die Wissenschaftskommunikation ist es umso wichtiger, sich dessen bewusst zu sein – und gegenüber Stakeholdern immer wieder auf wissenschaftliche Logiken zu verweisen und diese transparent zu machen.
3.3 Einordnung kann Tatsachen schaffen
Diese eingeforderte Sachlichkeit ist umso schwieriger einzuhalten, als die bloße Einordnung von politischen Entwicklungen in volatilen Situationen bereits Tatsachen schaffen kann. Die bereits erwähnte Diskussion um den Revolutionsbegriff verdeutlicht dies. Denn dieser wurde von Aktivist*innen als politische Losung ausgerufen. Als Zielsetzung beschreibt er, was diese Aktivist*innen anstreben – nämlich einen Sturz des existierenden politischen Systems im Iran. Dies lässt sich beschreiben, ohne den Begriff zu übernehmen. Wird er aber übernommen, dann greift es diesem Ziel vor: Die Revolution hat demnach bereits begonnen. Eine solche Einordnung hat potenziell weitreichende Konsequenzen. Denn iranische Behörden legitimieren Repressionen oft, indem sie Protestierende als von ausländischen Kräften unterstützte Umstürzler darstellen. Nach den Protesten 2009 beispielsweise legten zahlreiche Aktivist*innen öffentliche, möglicherweise erzwungene Geständnisse ab, von ausländischen Regierungen zum Umsturz der Islamischen Republik angestachelt worden zu sein (Naji 2015). Die Geständnisse erfolgten im Rahmen von politischen Prozessen, mit denen Protestierende eingeschüchtert werden sollten. Amnesty International hielt in einem Bericht über diese Prozesse fest, dass die ausländische Berichterstattung explizit in der Anklageschrift genannt wurde – neben Menschenrechtsorganisationen und ausländischen Regierungen (Amnesty International 2009). Für Aktivist*innen kann allein der Kontakt zu Ausländer*innen Konsequenzen haben und bestehende Restriktionen verschärfen (Rivetti 2017). Da die Prozesse politisch motiviert sind und nicht in einem rechtstaatlichen Rahmen stattfinden, sind solche Kontakte und Berichterstattungen für die Beweisführung eher unwichtig. Sie können aber einzelne Aktivist*innen ins Visier der Behörden geraten lassen. Wenn aber festgenommene Aktivist*innen in der internationalen Presse als Revolutionäre dargestellt werden, birgt dies die Gefahr, dass dies im Iran zur Kenntnis genommen wird – mit ernstzunehmenden Konsequenzen für Betroffene.
Diese Begrifflichkeiten spielen außerdem auch außerhalb des Irans eine politische Rolle. Denn sie prägen die Reaktion darauf, sowohl innerhalb der Diaspora als auch ausländischer Regierungen: Wenn ein Regimewechsel realistisch erscheint, sieht die Politik anders als, als wenn es das nicht tut. Regierungen könnten auf einen schnellen Regimewechsel hoffen, anstatt sich mit der amtierenden Regierung zu arrangieren, und beispielsweise über internationale Abkommen zu verhandeln. Iraner*innen in der Diaspora könnten, ebenfalls in der Hoffnung auf einen schnellen Regimewechsel, stärker öffentlich Position beziehen, als ohne diese Hoffnung – und sich damit potenziell Repressionen aussetzen. Umso mehr gilt es, verantwortungsvoll mit solchen Einschätzungen umzugehen. Ebenso beeinflusst die Frage nach Teilnehmerzahlen die Protestdynamik selbst. Aktivist*innen griffen auf soziale Medien wie Twitter und Instagram zurück, um die Bilder der Proteste breit zu streuen (Kumar 2022). So erschienen die Proteste bereits zu Beginn groß, und motivierten andere Menschen, sich an Protesten zu beteiligen. Wer in diesem Kontext von besonders kleinen Protesten oder besonders großen Protesten spricht, kann künftige Teilnehmerzahlen mit beeinflussen. Die deutschsprachige Berichterstattung spielt hier eine nachgeordnete Rolle, da sie eher über den Umweg der Diaspora relevant wird. Da aber die Berichterstattung im Iran selbst eingeschränkt ist, spielen Auslandssender der Diaspora ebenso wie persischsprachige Angebote aus westlichen Ländern (DW Persian, BBC Persian) eine große Rolle.
Es ist jedoch eine Dynamik, die über den iranischen Fall hinaus wichtig ist bei der Berichterstattung zu aktuellen Protestbewegungen. Die Sorgfaltspflicht, die der Wissenschaftskommunikation zu eigen ist, wird normativ umso wichtiger, wenn die eigenen Einschätzungen nicht ausschließlich im wissenschaftlichen Raum stattfinden, sondern potenziell die Risikoabwägung beteiligter Akteure und die Strafverfolgung staatlicher Behörden beeinflussen können.
3.4 Gatekeeperrolle
Forschenden kommt zudem regelmäßig eine Vermittler*innenrolle zu, wenn Medienschaffende neu zu einem Protest recherchieren und Zugang zu Aktivist*innen suchen. Im iranischen Kontext, wo wenige Medienhäuser Korrespondenten haben oder eigene Netzwerke unterhalten und die Pressefreiheit eingeschränkt ist, wird diese Rolle besonders deutlich. Während der Protestwelle 2022 äußerte sich dies beispielsweise in Anfragen nach möglichen Interviewpartner*innen vor Ort, aber auch in der Vermittlung von Kolleg*innen, die zu spezifischeren Themen arbeiten.
Diese Gatekeeperrolle stellt nicht per se ein Dilemma dar. Sie tangiert aber ethische Grundlagen der Arbeit in autokratischen Kontexten: Welche Informationen können überhaupt öffentlich kommuniziert werden, und auf welchem Wege kann die Zustimmung dazu auch retrospektiv eingeholt werden? Selbst eine Kontaktaufnahme kann manche Personen in kritischen Phasen gefährden. Zudem könnten Informationen über die eigene Forschung, die in einem peer-reviewten Kontext vielleicht unbedenklich waren, in Massenmedien so breit gestreut werden, dass unabsichtlich Bewegungsmuster und Kontaktpersonen identifiziert werden könnten. Informant*innenschutz, stets eine Voraussetzung der Forschung in kritischen Kontexten (Brounéus 2011), wird in akut volatilen politischen Lagen besonders wichtig. Und dieser geht über das bloße Einholen von Einwilligungen hinaus (Miller/Bell 2002). Nicht jeder Kontaktperson ist beispielsweise bewusst, welche Reichweite ein deutsches Medium hat und welche Gefahren hiervon potenziell ausgehen könnten. Gerade jüngere Kolleg*innen, die an relevanten Themen arbeiten und für die Wissenschaftskommunikation spannend wären, könnten durch eine verfrühte Kommunikation ihre künftige Forschung gefährden, wenn sie dadurch in den Fokus von Behörden geraten.
Diese Gatekeeperrolle beißt sich zudem mit zunehmenden Ansprüchen, Betroffene selbst zu Wort kommen zu lassen. Wer Iraner*innen über Proteste im Iran sprechen lässt, nimmt in Kauf, diese (und potenziell ihre Familien) zu gefährden – eine Abwägung, die in Absprache mit den Betroffenen stattfinden sollte (Brounéus 2011). Auch Retraumatisierung und unbeabsichtigte Effekte, wie das Offenlegen von Netzwerken, sind hierbei zu berücksichtigen. Ein informiertes Einwilligen ist für Kontaktpersonen nur durch stetige Neu-Aushandlung möglich (Miller/Bell 2002). Wenn aber zeitgleich Kommunikationskanäle durch Behörden überwacht werden, kann diese Aushandlung schwierig, langwierig oder unmöglich sein.
Letztlich gibt es hier keine eindeutige oder einfache Vorgehensweise und die individuelle Strategie ist stark von den jeweiligen Netzwerken und persönlicher Betroffenheit abhängig. Als Protestforscher*in gilt es vor allem, sich der eigenen Gatekeeperrolle bewusst zu sein – und diese verantwortungsvoll auszufüllen. Oft genug bedeutet dies angesichts unterschiedlicher ethischer Vorgehensweisen in Medien und Wissenschaft, Anfragen auch zu verneinen und die eigene Rolle zu reduzieren. In manchen Situationen bedeutet ethische Wissenschaftskommunikation eben, sich aus dieser zurückzuziehen.
4 Die Rolle von Protestforschung in Mediendiskursen
Wenn die Protestforschung sich weiter institutionalisiert, und gleichzeitig das Interesse an Protest als empirischem Phänomen zunimmt, wird es unweigerlich eine größere Nachfrage nach Wissenschaftskommunikation aus der Protestforschung geben. Für Wissenschaftler*innen stellen sich praktische und ethische Fragen im Umgang damit. Anhand eigener Erfahrungen im Kontext der iranischen Proteste 2022 wurden in diesem Beitrag einige dieser Fragen skizziert.
Die Rolle der Protestforschung selbst wird sich verändern und in jedem konkreten Kontext etwas abweichen. Die Wissensproduktion zum Iran ist, anders als in anderen Bereichen, sehr stark durch außenpolitische Expertise geprägt. Dies beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung der Protestforschung zu diesem Themenkomplex, ebenso wie die gestellten Fragen und Deutungsmuster. Wie bereits im ersten Abschnitt argumentiert, stellt die originär aus der Protestforschung entstammende Wissensproduktion eine Ergänzung dar, welche zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen kann. Ihr kommt damit eine wichtige erweiternde und komplementäre Rolle zu, die von anderen Disziplinen so nicht erfüllt werden kann. Gleichzeitig sieht sich eine Protestforschung, die diese Herausforderung annimmt, einigen Dilemmata ausgesetzt, von denen vier spezifiziert wurden. Unübersichtliche akute Situationen erfordern teils unmögliche Einordnungen, bei denen für ein Verständnis für Unwissen geworben werden muss. Ebenso begibt sich die institutionell wissenschaftsnahe Disziplin in eine wissenschaftsferne, politisierte Debatte, in der ihre Herangehensweise in politischen Grabenkämpfen unterzugehen droht. Dass solche Einschätzungen zudem politische Auswirkungen haben und dass die Gatekeeperrolle, die ihr teilweise zukommt, zudem eine große Verantwortung erzeugt, erfordert Reflexion und Vorsicht im Umgang mit öffentlichen Diskursen zu aktiven Protestlagen. Eine Verantwortung, die niemanden von der Wissenschaftskommunikation abhalten, sondern zu einer besseren ermutigen sollte.
Hinweis
Dieser Artikel/Beitrag ist im Rahmen des Forschungsprojekts „Postkoloniale Hierarchien in Frieden und Konflikt“ [Förderkennzeichen 01UM2205A] entstanden, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Über den Autor
Tareq Sydiq ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Konfliktforschung in Marburg, wo er das Netzwerk »Postcolonial Hierarchies in Peace and Conflict« koordiniert und das Projekt AFPRO leitet.
Literatur
Amnesty Internationa 2009: Iran: Election contested, repression compounded. https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/123/2009/en/
Bayat, Asef 2020: Revolution without revolutionaries: Making sense of the Arab Spring. Stanford University Press.10.1515/9781503603073
Baumann, Rainer,/Stengel, Frank A. 2014: Foreign policy analysis, globalisation and non-state actors: State-centric after all?. Journal of International Relations and Development, 17, 489–521.10.1057/jird.2013.12
Borgers, Michael 2020: Virologe Drosten kritisiert Medien. Deutschlandfunk. https://www.deutschlandfunk.de/berichterstattung-zur-coronakrise-virologe-drosten-100.html
Brady, Henry E., Verba, Sidney und Schlozman, Kay L. 1995: Beyond SES: A resource model of political participation. American political science review, 89(2), 271–294.10.2307/2082425
Brounéus, Karen 2011: In-depth interviewing: The process, skill and ethics of interviews in peace research. In Understanding peace research, 130–145. Routledge.
Buechler, Steven M. 1993: Beyond resource mobilization? Emerging trends in social movement theory. The Sociological Quarterly, 34(2), 217–235.10.1111/j.1533-8525.1993.tb00388.x
Bünger, Clara 2023: Konsequenzen aus der #IranRevolution ziehen – Für einen echten Abschiebestopp! Gemeinsame Erklärung der fluchtpolitischen Sprecherinnen der LINKEN im Bundestag, in den Landtagen und im Europaparlament. https://cms.clarabuenger.de/uploads/Fuer_einen_echten_Abschiebestopp_Iran_Erklaerung_fluchtpolitische_Sprecherinnen_LINKE_ace81f438e.pdf
Bush, Ray 2010: Food riots: Poverty, power and protest 1. Journal of Agrarian Change, 10(1), 119–129.10.1111/j.1471-0366.2009.00253.x
Davies, James C. 1962: Toward a theory of revolution. American sociological review, 5–19.10.2307/2089714
Hardt, Jürgen 2023: CDU-Politiker Jürgen Hardt: Unser Ziel im Iran muss Regime Change sein. Berliner Zeitung. https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/gastbeitrag-sanktionen-teheran-aussenpolitischer-sprecher-der-cdu-csu-bundestagsfraktion-juergen-hardt-unser-ziel-im-iran-muss-der-regime-change-sein-li.306167Suche in Google Scholar
Hermann, Rainer 2022: Die Mullahs stürzen noch nicht. FAZ. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/proteste-in-iran-wie-aktivisten-besonnene-kritiker-bedrohen-18443592.html
de Hoog, Niels/Morresi, Elena 2022: Mapping Iran’s unrest: how Mahsa Amini’s death led to nationwide protests. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/oct/31/mapping-irans-unrest-how-mahsa-aminis-death-led-to-nationwide-protests
Kamel, Lorenzo/Huber, Daniela 2015: Arab Spring: A decentring research agenda. Mediterranean Politics, 20(2), 273–280.10.1080/13629395.2015.1033901
Kastilan, Sonja 2020: Die Stunde der Virologen. FAZ. https://www.faz.net/aktuell/wissen/coronavirus-der-showdown-der-corona-experten-16700929.html
Kumar, Raksha 2022: Not quite the Arab Spring: how protestors in Iran are using social media in innovative ways. Reuters Institute. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/not-quite-arab-spring-how-protestors-iran-are-using-social-media-innovative-ways
Lacher, Hannes. 2003: Putting the state in its place: The critique of state-centrism and its limits. Review of International Studies, 29(4), 521–541.10.1017/S0260210503005217
Levine, Mark 2013: Theorizing revolutionary practice: Agendas for research on the Arab uprisings. Middle East Critique 22.3, 191–212.10.1080/19436149.2013.818194
Lynch, Marc 2014: The Arab uprisings explained: New contentious politics in the Middle East. Columbia University Press.10.7312/lync15884
Miller, Tina/Bell, Linda 2002: Consenting to what? Issues of access, gate-keeping and ‘informed’ consent. Ethics in qualitative research, 53, 69.10.4135/9781849209090.n3Suche in Google Scholar
Naji, Kasra 2015: Jason Rezaian trial: What are Iran’s Islamic Revolutionary Courts? BBC Persian. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32890565
Ouaissa, Rachid/Pannewick, Friederike/Strohmaier, Alena 2021: Re-Configurations: Contextualising Transformation Processes and Lasting Crises in the Middle East and North Africa. Springer Nature.10.1007/978-3-658-31160-5
Power, Séamus A. 2018: The deprivation-protest paradox: How the perception of unfair economic inequality leads to civic unrest. Current Anthropology, 59(6), 765–789.10.1086/700679
Rivetti, Paola 2017: Methodology matters in Iran: researching social movements in authoritarian contexts. Anthropology of the Middle East 12.1, 71–82.10.3167/ame.2017.120106
Verba, Sidney/Schlozman, Kay L./Brady, Henry und Nie, Norman H. 1993:. Citizen activity: Who participates? What do they say?. American Political Science Review, 87(2), 303–318.10.2307/2939042
Zamirirad, Azadeh 2022: Warum die Iran-Debatte immer toxischer wird. Süddeutsche Zeitung. https://www.sueddeutsche.de/kultur/iran-diaspoa-deutschland-1.5696302Suche in Google Scholar
Zekri, Sonja 2022: Immer noch Sturm. Süddeutsche Zeitung. https://www.sueddeutsche.de/kultur/iran-friedrich-ebert-stiftung-hetze-im-netz-1.5712003
Foto: Leonhard Lenz (cc 0) bei Wikimedia