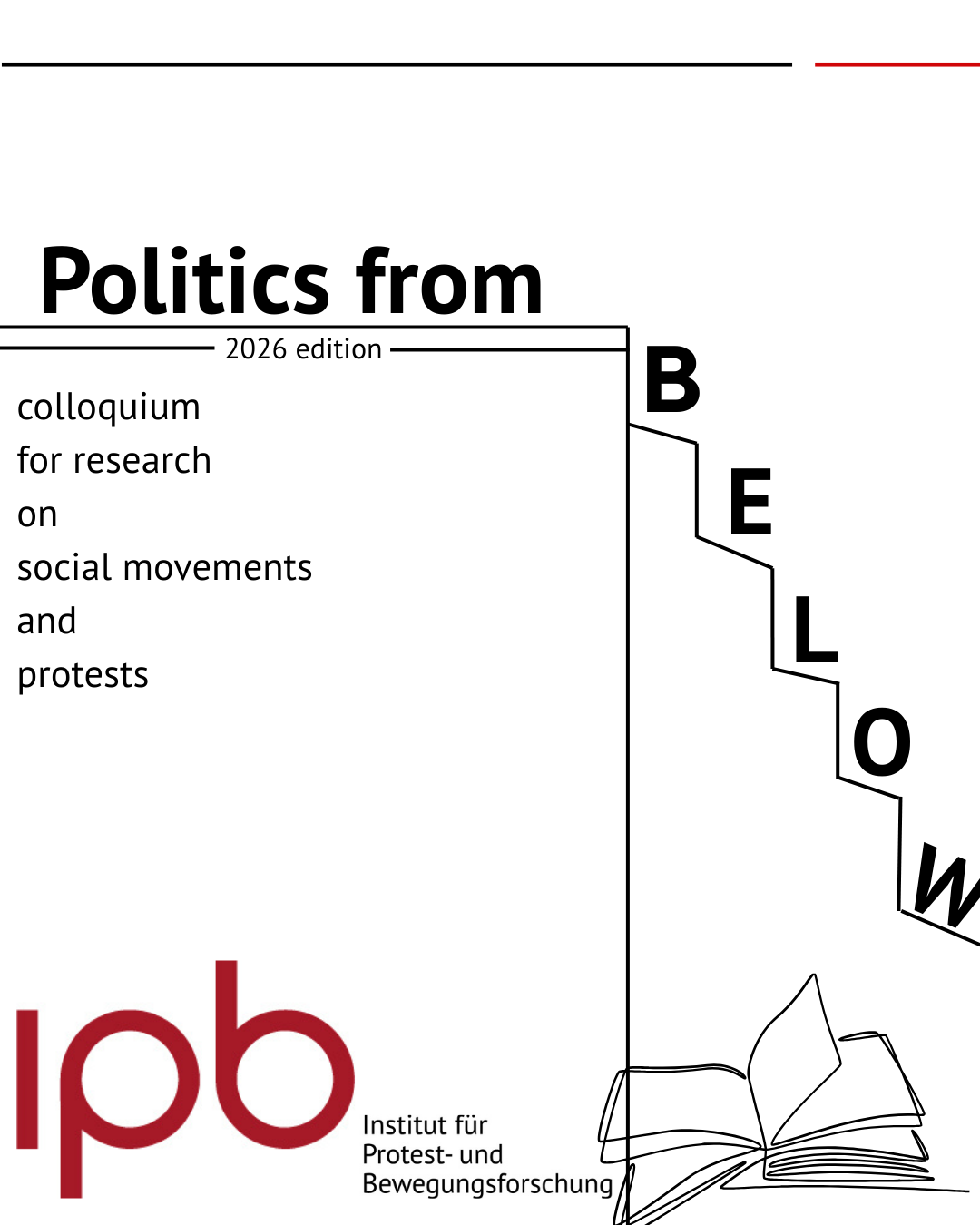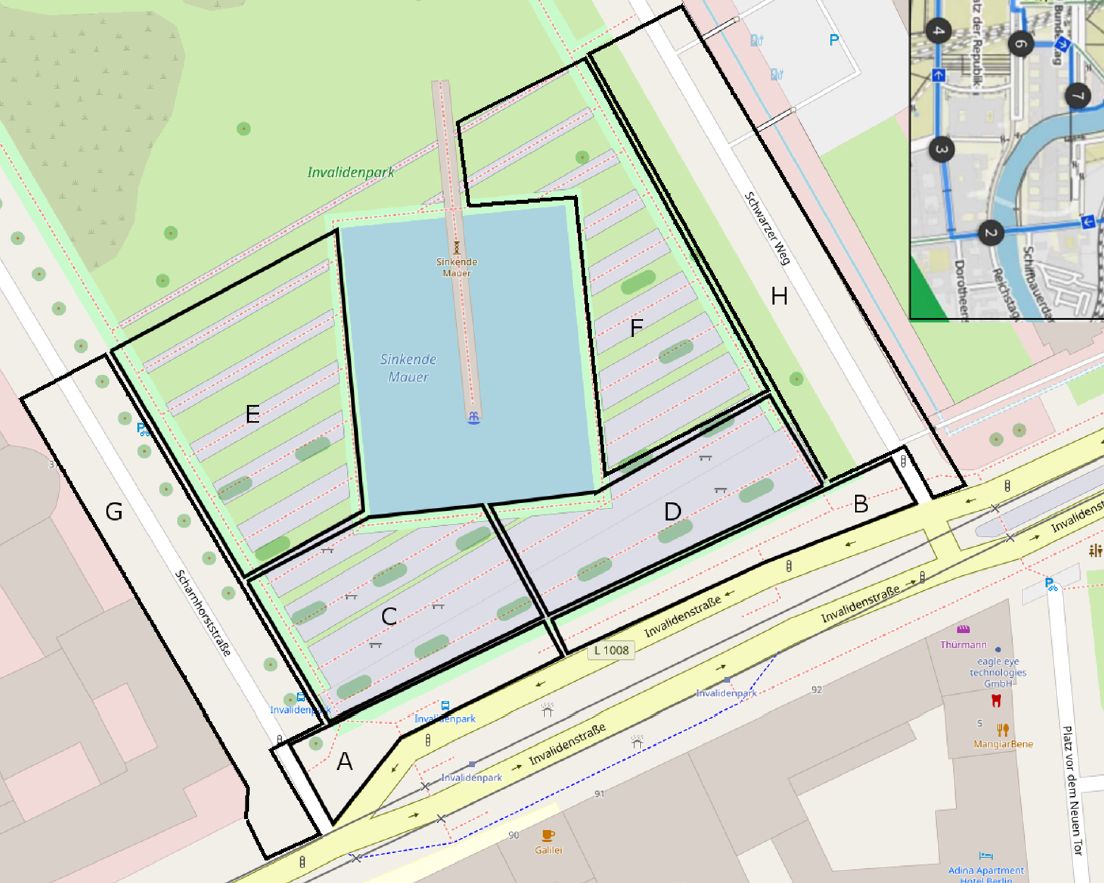– Institut für Protest- und Bewegungsforschung
Protest und soziale Bewegungen verstehen
Im ipb arbeiten über 200 Forschende zusammen. Sie forschen gemeinsam zu aktuellen und vergangenen Protesten. Sie tauschen sich in Arbeitskreisen, Workshops und Konferenzen aus. Und sie tragen das Wissen in die Öffentlichkeit.
Proteste sind allgegenwärtig – von der Bürgerinitiative gegen eine Umgehungsstraße zur Revolte in autoritären Regimen, von rechtsradikalen Aufmärschen zu mit Graffiti versehenen Wänden. Trotz der offensichtlichen Bedeutung von Protesten und sozialen Bewegungen für die Demokratie wissen wir nur wenig über ihre Dynamik. Wen treibt es zu Protesten auf die Straße, wer findet andere Formen des Widerstandes? Unter welchen Bedingungen sind Demokratiebewegungen erfolgreich und wann scheitern sie? Wenn die Menschen sich zunehmend digital vernetzen, wie wandelt sich die Rolle von politischen Organisationen? Welches Engagement schafft eine demokratische Kultur, welches fördert Diskriminierung?
Um solche und andere Fragen zu beantworten, bedarf es systematischer Analysen. Die sozialwissenschaftliche Forschung zu dem Thema im deutschsprachigen Raum ist aber episodisch und lückenhaft. Das Institut für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) will diese Lücke füllen. Es ist ein Arbeitszusammenhang, in dem dauerhaft zu einer ‚Politik von unten‘ geforscht wird. Dabei bringt das ipb Wissenschaftler_innen aus Deutschland, Europa und dem Rest der Welt zusammen, um sich auszutauschen und gemeinsam zu forschen.
Die Initiative zur Gründung des Instituts geht auf eine Gruppe von Wissenschaftler_innen zurück, die zu diesem Zweck den Verein für Protest- und Bewegungsforschung gründeten. Die Institutsinitiative hat in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und der Technischen Universität Berlin im Frühjahr 2013 ihre Arbeit aufgenommen.
Termine
Veranstaltungen
Aktuelles
Hier finden sich Kommentare zum aktuellen (Protest-)Geschehen und Neuigkeiten aus der laufenden Arbeit des Instituts.

Call for Participation – ipb online Kolloquiums-Reihe „Politik von unten“ Frühling 2026
Mehr erfahren: Call for Participation – ipb online Kolloquiums-Reihe „Politik von unten“ Frühling 2026Das Institut für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) lädt herzlich zur Einreichung von Beiträgen für seine Kolloquiums-Reihe „Politik von unten“ ein. Wir freuen uns gleichermaßen über Beiträge von allen Forscher*innen, Nachwuchswissenschaftler*innen wie auch von etablierten Forscherinnen! Bei Interesse freuen wir uns über eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung an info@protestinstitut.eu bis zum 18. März 2026

Workshopbericht: Protest Policing in Hybrid Publics. Third Parties in Relation to Protest and Policing
Mehr erfahren: Workshopbericht: Protest Policing in Hybrid Publics. Third Parties in Relation to Protest and PolicingEin Workshop des AK Polizei zeigt, wie „Dritte“ – von Medien und Passant:innen bis zu Plattformen und privaten Sicherheitsdiensten – Protest und Polizeihandeln in hybriden Öffentlichkeiten mitprägen. Anhand internationaler Beispiele wird sichtbar: Nicht-staatliche Akteure können Protest sowohl schützen als auch repressiv beeinflussen.

20 Jahre Protestbefragungen: ipb macht Daten zugänglich
Mehr erfahren: 20 Jahre Protestbefragungen: ipb macht Daten zugänglichBefragungen bei Demonstrationen sind eine wichtige Methode, um die Motive, Einstellungen und soziodemografischen Merkmale der Teilnehmenden zu verstehen. Das ipb macht jetzt 31 Protestbefragungen aus Deutschland und Polen über GESIS anderen Forschenden und der Öffentlichkeit zugänglich.
Bereiche und Aktivitäten
Mehr Informationen über das Institut, seine Aktivitäten und Mitglieder finden sich auf den folgenden Seiten.
Das ipb in den Medien
- Wir haben viele Möglichkeiten, uns zu beteiligen, wenn wir uns nicht überfordern lassen, nicht zurück ziehen, sondern unser soziales und politisches Engagement gut einteilen und auch effektiv ausrichten.
hr2, 25.2.2026: „Diese Vielfalt von Krisen führt dazu, dass es noch weniger durchschaubar erscheint“Matthias Quent (HS Magdeburg-Stendal)
[Die Aktivist*innen der Letzten Generation] „haben extrem effektiv verschiedene Formen von Protesten neu erfunden. Darin, mit sehr wenigen Akteuren, die Medienaufmerksamkeit zu maximieren, waren sie sehr erfolgreich“. […] „Am Ende ist es ihnen tatsächlich gelungen, das Bild zu erzeugen, dass der Alltag gestört wurde,“ sagt Teune, obwohl das öffentliche Leben freilich nicht ganz stillstand. […] Aber, und hier kommt das große Aber: Die große Aufmerksamkeit helfe nicht, „wenn es nicht gelingt, mit der Störung zu vermitteln, was damit bezweckt wird“.
Die Presse, 20.2.2026: Großprozess gegen „Letzte Generation“: Was hat der Protest gebracht?
Simon Teune (FU Berlin)
Die öffentlichen Debatten haben sich ganz klar mit dem Auftreten der Straßenblockaden der Letzten Generation komplett verschoben. Es gibt eigentlich keinen positiven Bezug mehr auf die Klimabewegung, sondern die Klimabewegung wird als Problem dargestellt und als Sicherheitsrisiko.
3sat Kulturzeit, 17.2.2026: Kriminelle Klima-Kleber?
Simon Teune (FU Berlin)
Letztendlich ging es darum, mit einer relativ einfachen Technik eine wahnsinnig große Reichweite zu bekommen. Ein weiterer Punkt war: Radio hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. […] Also unmittelbare Kommunikation. Die große Vision war, einen Ort der Kommunikation zu schaffen, dass Menschen zusammenfinden, gemeinsam ins Gespräch kommen und zusammen überlegen: wie werden wir stärker, um Lösungen für unsere Probleme zu finden.
Golem.de Podcast Besser Wissen, 10.2.2026: Politische Radiopiraten in Deutschland: Ein Blick zurück auf Theorie und Technik
Jan Bönkost (Uni Münster)
Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke forderte 2017 ein Ende der „dämlichen Bewältigungspolitik“. Von solchen Möglichkeiten sei die Partei im Bund allerdings auch deshalb weit entfernt, weil die Gedenkkultur und Aufarbeitung der NS-Zeit in der Mitte der Gesellschaft verankert sei. Das Besondere daran: Diese Aufarbeitung sei eben gerade nicht „von oben“ verordnet gewesen. „Die kritische Holocaust-Aufarbeitung und Erinnerung wurde von der Zivilgesellschaft angestoßen und erst später von der Politik aufgenommen.“
Neue Osnabrücker Zeitung, 9.2.2026: Die AfD und der Holocaust – so will die Partei das Geschichtsbild der Deutschen umkrempeln
Sabine Volk (Uni Tübingen)
Wenn die extreme Rechte an der Macht ist, berühre dies die gesamte Gesellschaft – nicht nur Parlamente und Gerichte, sondern auch den Arbeitsplatz und das Alltagsleben vor Ort. „Das heißt aber auch: Wir alle können genau dort aktiv werden, wo wir uns bewegen – bei der Arbeit, in der Schule, im Sport- oder Faschingsverein, im Stadtteil oder Dorf“.
Stuttgarter Nachrichten, 6.2.2026: Was die Demokratie schützt
Daniel Mullis (mit Victoria Gulde)
Nach dem Niedergang der sogenannten Globalisierungskritik hat die gesellschaftliche Linke generell an Einfluss verloren. Viele waren aber auch frustriert über die Rigidität der Kämpfe um Antisemitismus und Nahost in den Nullerjahren. Einige linksradikale Gruppen stellten deshalb in den Zehnerjahren dann doch wieder Gemeinsamkeiten in den Vordergrund, um sich nicht noch weiter selbst zu marginalisieren und gegen das Austeritätsregime bündnisfähig zu werden. Das ging allerdings oft nur, indem das Thema ausgespart wurde.
Der Freitag, 31.1.2026: Peter Ullrich: „Manche verorten Antisemitismus nur noch bei Migranten und Linken“
Peter Ullrich (TU Berlin)
Während des Wahlkampfs wurde häufig eingewendet, dass die Massenmobilisierung der Kampagne nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten sein werde. Zur Unterstützung Mamdanis hatten mehr als 100 000 Freiwillige an über drei Millionen Haustüren geklopft. Doch der Bürgermeister und seine Mitstreiter von den Democratic Socialists of America (DSA) hatten stets betont, dass die Massenmobilisierung notwendig bleiben werde, um die von Konzernen und Milliardären gekaperten Institutionen zur Verantwortung ziehen zu können. Das »Office of Mass Engagement« soll unterrepräsentierten Gruppen – also Menschen, denen Zeit, Geld oder die Beziehungen fehlen, um sich Gehör zu verschaffen – den Zugang zu den Institutionen erleichtern.
nd, 29.1.2026: Die ersten Wochen Mamdanis
Margit Mayer (FU Berlin)
Die Niederschlagung der Proteste im November 2019 galt bisher als Tiefpunkt im Umgang des Systems mit Protestierenden. Nun aber liegen die Todeszahlen um ein Vielfaches darüber. Schwer vorstellbar, wie der Staat hier zurückrudern und dauerhaft wieder mit weniger Gewalt herrschen soll. […] wenn die Islamische Republik noch Vertrauen außerhalb ihrer engsten Kreise genoss: Damit dürfte es endgültig vorbei sein.
Zeit Online, 26.1.2026: Jetzt bleibt den Herrschenden nur noch Gewalt
Tareq Sydiq (Uni Marburg)
Sehr häufig ist in den Interviews [mit den Menschen, die besonders destruktiv waren] herausgekommen, dass sie viele Verwundungen im Leben hatten, viele Blockaden gesehen haben: es geht nicht mehr weiter mit dem Aufstieg oder es geht nicht so voran mit der Gesellschaft. Wir haben das Nullsummendenken genannt. Das ist zentral um die Zerstörungslust zu erklären, dass sie so rechts geworden ist.
Falter Radio, 18.1.2026: Was tun gegen einen demokratischen Faschismus
Oliver Nachtwey (Uni Basel)
Viele Demonstrierende in Iran treten nicht vordergründig für ein bestimmtes politisches System an, sagt Sydiq, sondern für ein Thema: Umwelt, Frauenrechte, Wirtschaft. Sich auf einen Inhalt zu konzentrieren, könne Akteuren mehr Redefreiheit in Iran ermöglichen, weil ihr Protest keine Generalkritik am Regime darstelle.
Spiegel Online, 18.1.2026:Wer protestiert gegen das Regime? Ein Blick auf Irans Opposition
Tareq Sydiq (Uni Marburg)
Es hat überhaupt keinen Sinn, die Augen zu verschließen vor den Problemen der Welt. Davon verschwinden sie nicht. Im Gegenteil: Wenn wir nicht tätig werden, wenn wir nicht die Hoffnung haben, etwas zum Besseren verändern zu können, erst dann gibt es die Sicherheit, dass alles noch schlimmer wird. Wichtig ist, dass wir die Ohnmacht reflektieren, dass wir darüber reden. Natürlich sind wir ohnmächtig in ganz vielen Fragen. Aber dieses Eingeständnis kann den Blick darauf wenden, wo wir nicht ohnmächtig sind. Und daraus kann eine Energie entstehen, die auch gesellschaftlich die Weichen in eine andere Richtung stellt.
BR2, 16.1.2026: Demokratie als Aufgabe
Matthias Quent (HS Magdeburg-Stendal)
Grundsätzlich hält Teune es daher für möglich, dass sich auch aus dem rechtsextremen Spektrum noch Proteste formieren könnten – etwa dann, wenn sich das Thema vor den Landtagswahlen als politisch nützlich erweisen würde. Für Konservative sei jedoch Protest nicht das Mittel der Wahl, um politische Unzufriedenheit auszudrücken.
euronews, 13.1.2026: Nach Terror-Anschlag auf Berliner Stromnetz: Warum es keine Demos gab
Simon Teune (FU Berlin)
„Es kann also gut sein, dass Menschen zu Demos bezüglich beider Themen gegangen sind, um gegen den Bruch des Völkerrechts zu demonstrieren.“ Zudem gebe es Gemeinsamkeiten: „Sowohl die USA als auch Israel setzen das ‚Recht des Stärkeren‘ gewaltsam durch“, erklärt Anderl. „Das gibt durchaus Anlass zur transnationalen Mobilisierung.“
nau.ch, 11.1.2026: „Free Maduro“: Darum jubeln Palästina-Linke Venezuela-Diktator zu
Felix Anderl (Uni Marburg)
Auch in dieser Protestwelle haben wir es mit einem Sammelsurium an Themen zu tun. Die Akteure sind sich oft nicht unbedingt einig in ihren Forderungen oder darin, was eigentlich die Hauptforderungen sind. Daher sind die Aktionen ja auch so dezentral, es gibt keine zentrale Organisationsstruktur. Wir sehen Feministinnen, ethnische Minderheiten, Arbeiter oder auch Anhänger der Monarchie. In dem Moment, wo die Protestepisode losgeht, gehen die unterschiedlichen Gruppen für ihre Anliegen auf die Straße. Diesmal hat es eben mit wirtschaftlichen Forderungen begonnen.
Tagesspiegel, 10.1.2026: „Die Forderungen werden radikaler“: Können die Proteste im Iran zum Regimesturz führen?
Tareq Sydiq (Uni Marburg)
„Die Proteste sind immer wieder ein Stresstest für das System“, sagt der Politikwissenschaftler Tareq Sydiq von der Universität Marburg. Diese Momente zwängen das System inmitten einer politischen Krise zur Reaktion. Dabei könne die Staatsmacht Fehler machen, „die sich vielleicht akkumulieren und zu einem Regime Change oder Systemkollaps führen.“ Gleichzeitig erhalte der Staat die Gelegenheit, seine Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
dpa, 8.1.2026: Wut ohne Hoffnung – Neuer Stresstest für Irans Staatsmacht
Tareq Sydiq (Uni Marburg)
Auch in der radikalen Linken gebe es Kritik an solchen Aktionen, sagt Teune und spricht von „roten Linien“, die hier überschritten wurden. „Ein wesentlicher Punkt ist, dass solche militante Aktionen nicht Selbstzweck sein dürfen, sondern dass sie eine politische Botschaft vermitteln müssen.“ Etwa bei Blockaden von Castortransporten oder Sabotage an Atomanlagen sei deutlich, wogegen sich die Aktion richte.
Berliner Morgenpost, 7.1.2025: Soziologe zu Brandanschlag: Den Tätern gehe es „um den Schaden selbst“
Simon Teune (FU Berlin)
Die Rede von Feminismus von Rechts ist aus Leidingers Perspektive falsch: Feminismus könne nie antidemokratisch sein oder solle nie explizit rassistisch sein. Die Professorin betont, dass der zentrale Kern einer feministischen Analyse bei Lukreta fehle: Machtverhältnisse, patriarchale Strukturen und unterschiedliche Betroffenheiten blende Lukreta aus.
die tageszeitung, 1.1.2026: Feminismus von Rechts? Über die Masche von Lukreta
Christiane Leidinger (FH Düsseldorf)
In seinem Buch Die neue Protestkultur dokumentiert Sydiq den identitätsstiftenden Faktor von Protesten in unterschiedlichen Ländern. Er wird allzu gern in der allgemeinen Wahrnehmung vernachlässigt. Dabei ist er maßgeblich, ob sich aus einer einmaligen Aktion aufgrund „kurzfristiger Empörung“ oder eines „moralischen Schocks“ über ein Ereignis ein langfristiges Engagement herausbildet.
Deutschlandfunk, 26.12.2025: Eine Beschwörung demokratischer Langsamkeit
Tareq Sydiq (Uni Marburg)
Wir haben seit [den Baseballschlägerjahren] ein sehr hohes Niveau rechter Gewalt […], wir haben mindestens seit 2014, 2015 eine Zunahme von rechtsterroristischen Strukturen, also diejenigen, die glauben, dass sie mit Gewalt eine völkische Reinheit herstellen können, indem sie versuchen, Menschen, die hier eingewandert sind oder Zuflucht gesucht haben, zu vertreiben.
WDR Podcast 18 Millionen, 12.12.2025: Wie normal ist Rechtsextremismus?
Fabian Virchow (FH Düsseldorf)