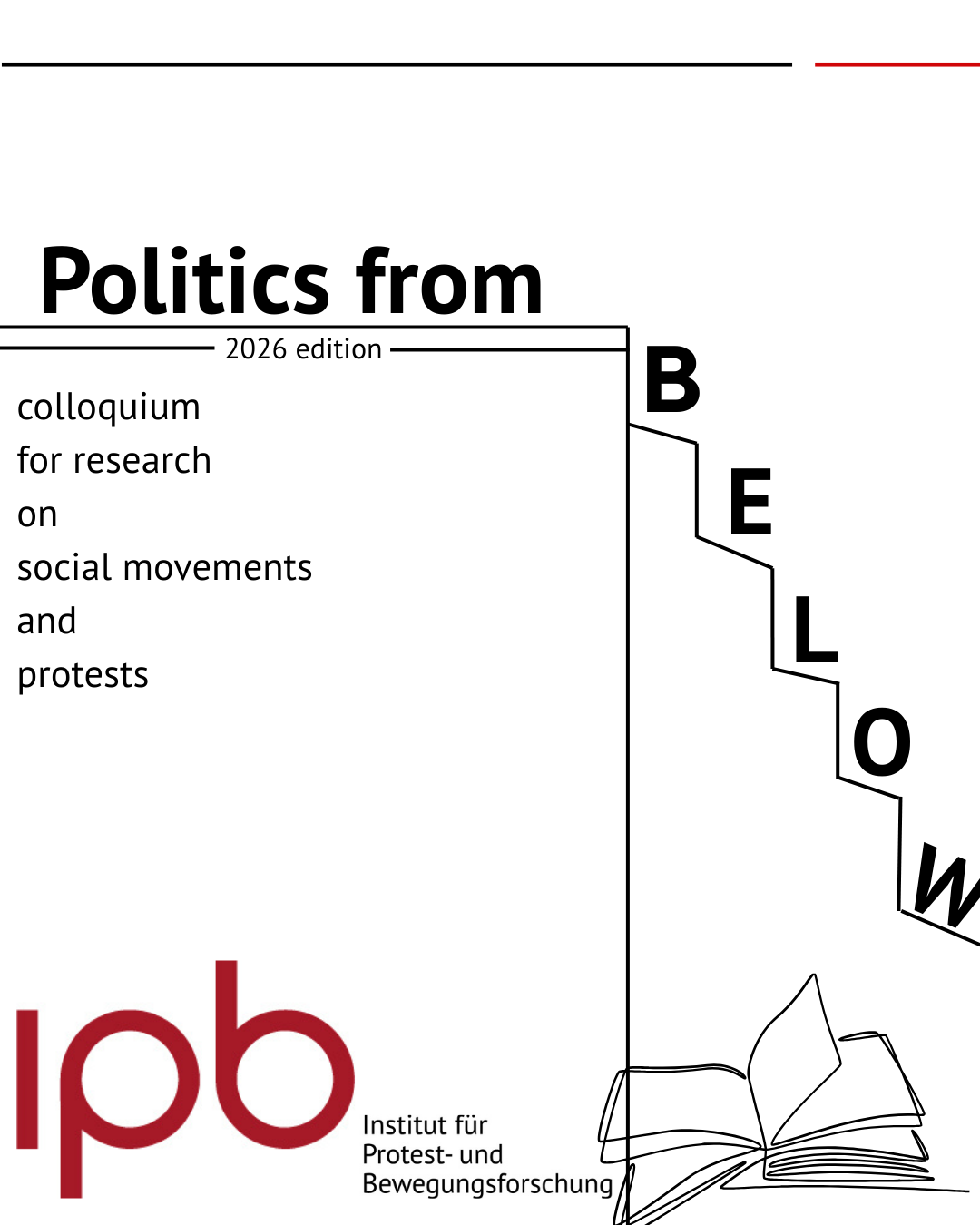2018 startet das Institut für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) eine eigene Rubrik im Forschungsjournal Soziale Bewegungen. Unter der Überschrift „ipb beobachtet“ kommentieren Mitglieder des Instituts aktuelle Entwicklungen im Feld und in der Debatte über soziale Bewegungen. Der Titel der neuen Rubrik ist vor diesem Hintergrund bewusst mehrdeutig: Einerseits geben Wissenschaftler*innen aus dem Umfeld des ipb ihre Beobachtungen zu aktuellen Forschungsdebatten wieder. Andererseits dient die Rubrik auch dazu, der vielfältigen Forschung unter dem Dach des ipb einen Raum zu geben, sprich diese genauer zu „beobachten“. Die Beiträge der Rubrik sind nach der Veröffentlichung auch auf unserem Blog zu lesen.
Bislang erschienen:
- Simon Teune und Peter Ullrich (1-2.2018): Zwischen politischem Auftrag und politischer Positionierung
- Jannis Grimm (3.2018): Im Fadenkreuz: Bewegungsforschung im Nahen Osten und Nordafrika
- Sabrina Zajak (4.2018): Das transformative Selbstexperiment in der Bewegungsforschung
- Roland Roth und Dieter Rucht (1.2019): Bewegung in der Bewegungsforschung
- Elias Steinhilper (2.2019): Zur Re-Dynamisierung migrationsbezogener Bewegungsforschung
Der folgende Text von Aletta Diefenbach, Philipp Knopp, Piotr Kocyba und Sebastian Sommer erschien im Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 31, Heft 3. Die Autor*innen sind Mitglieder des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung und aktiv im Arbeitskreis Rechte Protestmobilisierungen.
In Anbetracht der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Entwicklungen besteht kaum ein Zweifel daran, dass wir rechte Proteste und Bewegungen wissenschaftlich untersuchen müssen. Wie dies geschehen soll, darüber besteht aber großer Klärungsbedarf. Derzeit entzünden sich innerhalb und außerhalb[1] der deutschsprachigen Sozial- und Kulturwissenschaften teils heftig geführte Diskussionen darüber, wie man den neueren rechten Entwicklungen wissenschaftlich am besten Rechnung trägt. Das ist wenig verwunderlich. Die Bewegungsforschung ist zwar reich an Debatten und Vorschlägen, wie Forschende insbesondere progressive Politiken und Praktiken erschließen können und sollen.[2] Durch ihren Fokus auf linke politische Mobilisierungen[3] fehlte aber bisher eine Auseinandersetzung darüber, wie man mit rechten Bewegungen umgehen soll. Die aktuelle Methodendebatte ist daher mehr als begrüßenswert.
Auffällig an den bisherigen deutschsprachigen Beiträgen ist jedoch, wie stark die Eignung qualitativer bzw. interaktionsnaher sozialwissenschaftlicher Erhebungsmethoden in Frage gestellt wird. Ein Beispiel ist das Anfang des Jahres 2019 veröffentlichte Statement des „Forschungsnetzwerks Frauen und Rechtsextremismus“. Ausgehend von einer ethnographischen Studie, in deren Verlauf die forschende Person ein Liebesverhältnis mit einem Aktivisten der „Identitären Bewegung“ einging,[4] ziehen die Autor*innen weitreichende methodologische Schlüsse, wonach ethnographische Methoden kaum als „adäquates Mittel“ der Wissensproduktion über rechte Phänomene gelten sollen (Forschungsnetzwerk 2019: 2). Ein anderes anschauliches Beispiel bietet Robert Feustel (2019), der in seinem polemisierenden Artikel schlussfolgert, Interviews mit rechten Aktivist*innen seien aus einer kritischen Perspektive ebenfalls abzulehnen, da sie nicht zu neuen Erkenntnissen über rechte Einstellungen beitragen könnten.
Vor dem Hintergrund unserer eigenen Forschungen, die auch teilnehmende Beobachtungen an rechten Protesten und qualitative Interviews einschließen, finden wir derartige Einschätzungen irreführend. Statt pauschaler Ablehnung einzelner Forschungsmethoden muss es doch vielmehr darum gehen, zu diskutieren, welchen Fallstricken auszuweichen ist und welche Hürden genommen werden müssen, um das Potential qualitativer Methoden für die Ergründung rechter Ideologien und Praktiken auszuschöpfen. Wir können und wollen in der gebotenen Kürze keinen „Königsweg” präsentieren, wie man emanzipatorisch orientiert Erkenntnisse über politische Bewegungen von rechts gewinnen soll – einen solchen gibt es wohl auch kaum. Doch plädieren wir in diesem zweifelsfrei hochkomplexen und von Widersprüchen durchzogenen Feld für mehr methodische Offenheit und für eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Spannungen, die mit der Erforschung rechter Phänomene aus der Perspektive kritischer Wissenschaft, und speziell auch unter Rückgriff auf interaktionsnahe Methoden der Sozialforschung,[5] einhergehen.
Kritische Wissenschaft und rechte Bewegungen als Forschungsgegenstand – Ein Spannungsverhältnis
Um welche Spannungen geht es dabei? Die Wissenschaft hat über die Jahrhunderte spezifische Regeln der Wissensproduktion herausgearbeitet. Diese Regeln sind seit jeher umstritten. Insofern verdeutlichen auch die gegenwärtigen Debatten in der deutschsprachigen Soziologie,[6] dass die Diskussion über methodologische Kernfragen prinzipiell unabgeschlossen ist und fortwährend geführt werden muss; etwa mit Blick auf Ansprüche wie Objektivität und Werturteilsfreiheit oder auf das Erkenntnisinteresse von wissenschaftlicher Wissensproduktionen. Und das ist auch gut so!
Will man nicht in Relativismus und Beliebigkeit verfallen, dann gehört zu den in den Sozialwissenschaften weitestgehend anerkannten Erwägungen sicherlich die Idee, Erkenntnisse und theoretische Konzepte auf nachvollziehbare Weise zu konstruieren, sie mit einer bestimmbaren Reichweite zu generieren sowie dabei die eigene Standortgebundenheit zu reflektieren. Ähnlich, und dies ist insbesondere der qualitativen Sozialforschung eigen, verhält es sich mit dem Anspruch, eine größtmögliche Offenheit gegenüber dem betrachteten Phänomen zu bewahren, um es in seinen Ausprägungen und seiner Genese verstehen und erklären zu können. Gerade solch eine Offenheit ist die Stärke qualitativer Forschung, die vor allem neue Zusammenhänge und Komplexitäten aufzeigen will, anstatt deduktiv vorzugehen und Hypothesen quantitativ zu prüfen.
Insbesondere in der Protest- und Bewegungsforschung pflegen Wissenschaftler*innen häufig ein kritisches Selbstverständnis und verpflichten sich gegenüber demokratischen Werten wie Gleichheit und Freiheit, politischen Teilhaberechten von Marginalisierten sowie der Aufdeckung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen (Teune/Ullrich 2018). Das politisch wie gesellschaftlich erstarkende rechts-konservative Spektrum, das im weitesten Sinne Ideologien der Ungleichwertigkeit mobilisiert, steht vielfach in Opposition zu einer dergestalt kritisch verstandenen Wissenschaft. Das Verhältnis zwischen der Subjektivität der kritisch Forschenden, den Ansprüchen an wissenschaftliches Arbeiten und den politischen Positionen der rechten Bewegungen bildet somit ein mehrdimensionales Spannungsverhältnis.
Es manifestiert sich in unseren Forschungsinteressen, aber auch in der Art, wie wir Fragen stellen, in der Wahl der Theorien und in dem Wissen um den Gebrauch einer Methode. Es schlägt sich schließlich in der Interpretation der Daten und auch in der Kommunikation der Ergebnisse nieder. Aus der politischen Differenz speist sich der Appell, nicht jede Interaktion mit der bewegungsförmigen Rechten ethisch für angemessen zu erachten und eine kritische Auseinandersetzung anzustreben. Jedoch birgt die in den oben angeführten Debattenbeiträgen vertretene Ablehnung interaktiver Forschung auch die Gefahr, systematisch blinde Flecken zu produzieren. So sollte ein forschungsethischer Appell nicht dazu führen, den generellen Anspruch qualitativer Forschung, die zu erforschende Wirklichkeit in ihrer Strukturiertheit möglichst offen zu rekonstruieren, pauschal fallen zu lassen. Damit wäre ihr Potential verschenkt.
Potentiale der interaktionsnahen Datengewinnung anerkennen
Die Herausforderungen, die sich aus der politischen Differenz für die Datengewinnung ergeben, sind nicht zu unterschätzen und bilden daher auch den Kerngegenstand der Kritik an qualitativen Methoden. Hier gibt es praktische Hürden sowie forschungsethisch relevante Bedenken. Insbesondere das Forschungsnetzwerk listet eine Vielzahl von Problemen der „methodischen Zugänge“ auf, die „direkte Kommunikation mit den beforschten Personen“ (Forschungsnetzwerk 2019: 2) im Feld des Rechtsextremismus einschließt. Sie lehnen zum Beispiel die teilnehmende Beobachtung von öffentlichen Aktionen des extrem-rechten Spektrums ab, vor allem, wenn sie verdeckt erfolgt, weil die Forschenden „damit an ihrer medialen Reproduktion (mitwirken)“ (ebd.: 3). An anderer Stelle kritisieren sie, dass „eine Datenerhebung und -analyse, die von (un-)bewussten Sympathien für die Beforschten begleitet ist, (…) ihre Ergebnisse (verfälschen) (sic!) und (sich) für einen weiteren wissenschaftlichen Diskurs (disqualifizieren)“ würde (ebd.: 4).
Mit dieser Skepsis gegenüber interaktionsnaher Forschung hinterfragt das Netzwerk aber auch eine ganze Reihe von bisherigen, auch mutigen, Studien, die mittels ethnographischer Methoden in diesem Milieu gearbeitet haben. Eine Vielzahl von Forschenden haben sich in dieser Hinsicht bewusst auf zeitintensive, nahe Auseinandersetzungen mit Rechten aus unterschiedlichen Spektren eingelassen, sich mitunter explizit methodisch für Empathie (Hochschild 2016), gar Freundschaft (Teitelbaum 2017) oder für eine Forschung mit verdeckter Identität entschieden (Shoshan 2016). Sie alle reflektieren auf die eine oder andere Weise Schwierigkeiten während der Feldforschung, diskutieren aber auch, wie sich politische Differenz und Nähe produktiv integrieren lassen (siehe auch Back 2002; Pilkington 2016). Natürlich sind diese Studien im Einzelnen kritikwürdig. Gemein ist ihnen jedoch, dass sie uns über einen offenen, nicht vorab klar definierten Weg der Annäherungen, der auch moralische Dilemmata bereithält, ein dichtes und detailreiches Bild der Akteure mit rechten Einstellungen und Praktiken sowie von ihren historischen oder biographischen Werdegängen geben. Sie zeigen, wie rassistische Weltbilder mit anderen sozialen Bezügen wie Geschlecht, Emotionen, Klasse, Kultur, etc. verwoben sind. Damit können sie über die sonst gängigen Erklärungsmuster (nationalistische Ideologien und ökonomische Deprivationserfahrungen) hinausgehend differenzierter aufzeigen, was die Sogkraft rechter Zusammenschlüsse ausmacht.
Wir leugnen nicht, dass interaktive Forschung auch an Grenzen stößt. Nach Demonstrationsbefragungen bei PEGDIA mussten Forschende aufgrund der aggressiven Haltung der Protestierenden ernüchtert ihre bisherigen Methoden hinterfragen (Daphi et al. 2015). Doch auch hier gibt es Möglichkeiten zur methodischen Weiterentwicklung. Wie weitere Befragungen rechter Demonstrationen zeigen, lassen sich gefährliche Situationen erheblich verringern, wenn Forschende unmittelbar und eindeutig in dieser Rolle, und nicht etwa als Journalist*innen, wahrgenommen werden und zu identifizieren sind. Erfahrungsgemäß führten – bei PEGIDA – solche Unsicherheiten trotz Klärungsversuche zu heftigen (teilweise auch physischen) Anfeindungen. Als Forschende jedoch anfingen, Warnwesten mit der Aufschrift „Befrager“ zu tragen und einem entsprechenden Ausweis vorzeigen konnten, nahmen derartige Aggressionen ab.
Darüber hinaus zeigen die Beobachtungserfahrungen im Kontext von PEGIDA das Potential von größeren und divers aufgestellten Beobachtungsgruppen, sodass nicht nur unterschiedliche Wahrnehmungen des Protestereignisses, sondern ebenso unterschiedliche Erfahrungen aufgrund der zugeschriebenen Identität (z.B. als weibliche oder „nicht-deutsche“ Forscher*in) abgebildet werden können (Geiges et al. 2015: 40ff.). Daneben liefern „mixed-method“-Ansätze als Verbindung unterschiedlicher Feldzugänge Möglichkeiten, um Perspektiven zu erweitern bzw. unterschiedliche Blickwinkel abzubilden, indem etwa Ergebnisse aus teilnehmenden Beobachtungen mit quantitativen Befragungen (Daphi et al. 2015) oder Fokusgruppen (Geiges et al. 2015) trianguliert werden-
Wege und Offenheit in der Interpretation von Daten
Pauschale Ablehnung erfahren interaktionsnahe Methoden auch, weil von den Teilnehmenden an Befragungen und Interviews a priori „strategische Kommunikation“ erwartet wird. Dabei wird angenommen, dass die Interviewten keine im engeren Sinne forschungsrelevanten Aussagen tätigen (wollen) und die Forschenden „ausnutzen“, wenn nicht gar „bewusst manipulieren“ (vgl. Forschungsnetzwerk 2019: 3; siehe auch Feustel 2019).
Dabei ist man einer strategischen Kommunikation mitnichten hilflos aufgeliefert. Nicht nur bergen auch die offensichtlich strategischen Interaktionen einen Erkenntniswert – sie geben u.a. Aufschluss darüber, was aus der Perspektive der Befragten öffentlich sagbar ist oder wie sie mit Stigmatisierung umgehen. Die qualitative Sozialforschung kennt auch Wege, wie Einflüsse politischer, aber auch sozialer, kultureller, geschlechtsspezifischer etc. Differenzen im Forschungs- und Interpretationsprozess aufgedeckt und möglicherweise abgebaut werden können. Insofern greift der Vorwurf der strategischen Kommunikation zu kurz. Unbeachtet bleibt dabei, dass Interaktion stets auf Darstellungspraktiken beruht, die sowohl von den habituellen als auch situativen wechselseitigen Erwartungen der Interaktionsbeteiligten beeinflusst werden. Die Interaktionssituationen und ihre Bedingungen sind in der Dateninterpretation daher immer zu rekonstruieren und dabei ist die Rolle der Forschenden und die Erwartungen, die den Beforschten gegenüber gestisch und verbal ausgedrückt werden, zu berücksichtigen. Kathleen M. Blee (2017) wertet etwa unterschiedliche Interaktionsdynamiken aus Interviewsituationen in Studien über Frauen in der US-amerikanischen extremen Rechten der 1980er und 1990er Jahre aus. Sie deckt auf, wie in den Interviews ethnische Zuschreibungen wirken oder wie die Interviewten taktisch vorgehen, indem sie einschüchtern oder Angst erzeugen. Weiterhin erörtert sie, wie biographische Interviews solche strategischen Züge eindämmen können. Auch Dorit Roer-Strier und Roberta Sands (2015) rekonstruieren die verschiedenen Phasen von Interviews, in welchen die politische Differenz zwischen beiden Parteien zum Thema wurde. Sie diskutieren, wie die wechselseitige Anerkennung der gegensätzlichen Position half, die „offizielle Geschichte“ der Interviewten aufzubrechen, und detailreiche Einblicke in deren Gedankenwelt und Handlungsorientierungen ermöglichte.
Ebenfalls können Interpretationsgruppen so zusammengesetzt werden, dass sie eine größtmögliche Diversität von sozialen und politischen Positionen einschließen (Krueger 2008: 128). Idealerweise können Leser*innen durch eine ausführliche Dokumentation der Forschungsarbeit nachvollziehen, wie die Interpretationen der Gruppe zustande kommen. In einer kritischen Bewegungsforschung hat diese multiperspektivische Interpretationsstrategie gleichsam epistemologische Grundlagen. Denn Interpretationsgruppen ermöglichen auch, einen pluralistischen Forschungsanspruch einzulösen, der vielfach situierte Lebenswelten und Sichtweisen auf die Welt berücksichtigen will. Die Ko-Interpretation mit marginalisierten Personen bietet so eine Möglichkeit der Dezentrierung des meist weißen, mittelschichtsangehörigen Erkenntnissubjekts „Wissenschaftler*in“. Positionsplurale Offenheit ist somit dezidiertes Mittel kritischer Erkenntnis.
Offenheit in der Darstellung von Ergebnissen
Gerade qualitative Studien öffnen den Blick für Komplexitäten, Widersprüche und Mehrdeutigkeiten sozialer Praxis. So darf auch die kritische Wissenschaftskommunikation als „aktiver Zug im Ringen um Emanzipation und gerechte Verhältnisse“ (Slaby 2018: 79) diese Komplexitäten nicht reduktionistisch unterschlagen.
Die Entscheidungen, wie die Forschungsergebnisse veröffentlicht werden, fangen bereits bei den subtileren Spielräumen der stilistischen Textproduktion an. Forscher*innen können ihre Ergebnisse in einem nüchternen, distanzierten und Objektivität oder Neutralität vermittelten Ton formulieren. Sie können Ergebnisse aber auch in Ästhetiken niederschreiben, welche bereits politische Orientierungen und andere Stimmungen mittransportieren. Arlie Hochschild (2016) etwa wählt einen zugewandten Schreibstil, um die Lebensrealitäten der von ihr untersuchten rechten Südstaatler*innen in den USA zu beschreiben. „Empathie“ ist in gewisser Weise also auch in ihren Text eingeschrieben. Sie stellt nicht allein ein „wissenschaftliches Phänomen“ dar, sondern die „Menschen“ in ihrer Komplexität; sicherlich auch mit der Idee, den Leser*innen Platz für ein eigenes Urteil einzuräumen. Ganz anders verhält es sich mit Claus Leggewies frühem Buch „Der Geist steht rechts“ (1987), dessen reichhaltige „Ausflüge“ in die „Denkfabrik der Wende“ mit satirisch spöttelnden Seitenhieben gegen den politischen Gegner gespickt sind. Seine eigene politische Haltung und Geringschätzung sind unüberlesbar.
Darüber hinaus gibt es weitere Strategien, die Komplexitäten von Forschungsergebnissen kritisch zu rahmen. Die historische Rassismusforschung ermöglicht es etwa, verschiedene Einstellungen und Praktiken gegenüber Minderheiten aufzuzeigen und dazugehörige ausschließende Mechanismen als Entwicklungen weit zurückreichender Rassismusdiskurse aufzudecken. Aletta Diefenbach (2019) rahmt zum Beispiel die sowohl nuancierte als auch widersprüchlich vorgetragene „Islamkritik“ ihrer Interviewpartner*innen als Teil des neuen kulturalistischen Rassismusdiskurses. Rhetorisch wird hierbei nicht über „Rasse“, sondern „Kultur“ bzw. Religion Differenz hergestellt. Zudem wird zwar immer wieder versucht, das „muslimische Andere“ nicht pauschal abzuwerten, in der Gesamtschau bleibt es jedoch bei einer skeptischen Haltung, die einen ausschließenden Diskurs gegenüber Muslim*innen bewirkt.
Ebenso ist es denkbar, ausgrenzenden Sichtweisen die Perspektive von Betroffenen dieser Ausgrenzung gegenüberzustellen oder durch Kontextfaktoren und Datenquellen kritisch zu ergänzen. Ein Beispiel hierfür sind die Untersuchungen von Michael Kimmel (2013), der den Zorn der von ihm interviewten „angry white men“ in den USA zwar anerkennt und abbildet, ihn jedoch mit gesellschaftspolitischen Betrachtungen kontrastiert, vor allem mit den sozio-ökonomischen Entwicklungen. Er legt auf diese Weise die vorgefundenen Welterfahrungen als widersprüchlich und in seinen Augen fehlgeleitet dar.
Sicherlich bleibt bei all diesen möglichen Darstellungen die Frage unbeantwortet, wie etwa mit Erkenntnissen umgegangen werden soll, welche die politische Gegenseite womöglich (argumentativ) stärken können oder deren Sichtweisen unter Umständen untermauern. Daher wird es auch hier nicht die eine und alleinig richtige Strategie geben. Eine gewisse Pluralität von gemäßigt-neutralen bis radikal-energischen Positionen der Wissenschaftskommunikation erscheint hierbei strategisch sinnvoll, um Rechte letztlich nicht in ihrer vermeintlichen Opferrolle zu bestätigen.
Was wäre überhaupt die Alternative?
Wer rechte Protestbewegungen erforschen will, bewegt sich in einem vielschichtigen Spannungsfeld. Wir meinen, dass sich kritische Wissenschaft auf diese Spannungen reflexiv einlassen sollte, anstatt ihrem Gegenstand mit einer voreiligen – und im Kern illusorischen – Strategie der Kommunikationsverweigerung gegenüberzutreten. Die jüngst angestoßene Methodendiskussion im Bereich rechter Bewegungen sollte daher an bereits existierende Beiträge anschließen, sowie im Kontext der allgemeinen sozial- und kulturwissenschaftlichen Methodendebatten geführt werden. Reflexivität bedeutet an dieser Stelle auch anzuerkennen, dass die aufgezeigten Spannungsmomente womöglich nicht ganz aufzulösen sind. Die jeweiligen Lösungsansätze können und sollten für andere sichtbar gemacht werden, um eine fruchtbare Diskussion über die Erkenntnisstrategien kritischer Wissensproduktion voranzutreiben.[7]
Gerade die qualitative Methodologie entfaltet ihr „produktives Moment“ (Hametner 2013: 140) mit etwas mehr Zurückhaltung gegenüber dem eigenen Vorwissen. Als „Mittel der Öffnung“ (ebd.) problematisiert sie Vermutungen und räumt durch den Blick auf die alltäglichen Relevanzsetzungen und Handlungen der Akteure die Möglichkeit ein, Neues zu entdecken. Natürlich bleibt diese Offenheit durch die gesellschaftliche Situiertheit der Forschenden bedingt (ebd.) und bedarf immer wieder erneut forschungsethischer Abwägungen. Beides lässt sich aber nicht immer schon vorab reflexiv einholen. Oft können Fragen von Positionalität und Moral auch erst im Verlauf der Forschung erkannt werden und lassen sich dann auch nur situationsabhängig und kontextspezifisch beantworten (auch Freikamp 2008).
An Offenheit festzuhalten, bedeutet auch, sie möglichst zu bewahren, wenn man im Forschungsfeld auf Ablehnung trifft. Denn es wäre für eine kritische Wissenschaft fatal, dem rechten Freund-Feind-Denken mit kategorischer Ablehnung ihrer empirischen und nahen Erforschung zu begegnen. Gleichzeitig bedeutet Offenheit aber nicht Werturteilsfreiheit im Sinne einer kritiklosen oder unkommentierten Aufnahme rechter Diskurse oder Positionen, die es viel eher zu beschreiben und kritisch und mit anderen Ansichten zu rahmen gilt. Auf diese Weise können rechte Welterfahrungen und ihre ideologischen Deutungen als das erscheinen, was sie sind, nämlich eine Art, die (Alltags-)Realität zu ordnen, die zwar (leider) von vielen Personen geteilt wird und deshalb untersucht werden muss, jedoch keineswegs einen alleinigen Geltungsanspruch besitzt.
Aus unserer Sicht kann kritische Forschung mit progressivem Anspruch nicht bedeuten, sich gegenüber einem politisch widerstreitenden und kontroversen Gegenstand auf die eine oder andere Weise zu verschließen, indem bspw. allein der Weg in den Elfenbeinturm der theoretischen Kritik gewählt wird. So erscheinen die Implikationen einer Schließung wenig wünschenswert, da dies unter Umständen bedeutet, dass progressive Forschende die Deutungen eines gesellschaftspolitisch wichtigen Feldes anderen überlassen.
Denn es braucht einen Gegenpol zu politisch komplizenhaften Forschungen, wie zum Beispiel den Befragungsstudien von Werner Patzelt (2016), welche die „Veredelung des empirisch vorfindbaren Volkswillens“ als Hauptziel definieren und die Dimensionen ausgrenzenden Verhaltens systematisch herunterspielen oder diskursiv zu verschleiern versuchen, zum Beispiel durch sehr enge Rassismus-Definitionen oder die Verwendung euphemistischer Begriffe wie „kulturell begründete Sorgen“ anstatt Rassismus. Demgegenüber hat es alternative Darstellungen zu den Forschungen Patzelts gegeben – in Form fundierter Methoden- und Begriffskritik (Kocyba 2016a) und auf Grundlage empirischen Datenmaterials, die einer verniedlichenden Darstellung der PEGIDA-Demonstranten als „besorgte Bürger“ vehement entgegentreten (Kocyba 2016b). Die Herangehensweisen kritischer Wissenschaft – Theoriearbeit, Methodenkritik und empirische Forschung – sollten sich somit idealerweise ergänzen.
Die Forschung in den oftmals feindseligen Umgebungen rechter Proteste und rechter Bewegungsmilieus ist für Wissenschaftler*innen oft anstrengend und emotional aufreibend. Solange keine massiven forschungsethischen oder -praktischen Verfehlungen vorliegen, bedeutet das Gebot der Offenheit, eine methodische Heterogenität in der kritischen Forschung unaufgeregt anzuerkennen. Für den Umgang mit den skizzierten Fallstricken lässt sich abschließend auch folgende Einsicht in Erinnerung rufen: Wissenschaftliche Erkenntnis lebt von der (Möglichkeit ihrer) Falsifikation. Ergebnisse sind also immer als vorläufig zu verstehen, sollen kritisiert und im Zweifelsfall revidiert werden. Jede*r Forscher*in ist daher eingeladen, ja aufgefordert, es besser zu machen.
[1] Siehe für den angelsächsischen Raum u.a. Journal of Contemporary Ethnography (2/2007), Blee (2017), Teitelbaum (2019), Pasieka, (2019), Bangstad et al. (2019) uvm.
[2] Vgl. frühere Beiträge in dieser Rubrik von Ullrich/Teune (2018) oder Zajak (2018).
[3] Dieser Fokus schlägt sich z.B. anschaulich in der Gewichtung der Beiträge im Handbuch zu den „Sozialen Bewegungen in Deutschland ab 1945“ (Roth/Rucht 2008) nieder, wo es unter den 21 Kapiteln zu spezifischen Bewegungen nur einen einzigen Beitrag gibt, der sich nicht mit progressiven Bewegungen beschäftigt.
[4] Nach Angaben des Netzwerks ist die betreffende Person zwar von ihren Funktionen innerhalb der „Identitären Bewegung“ zurückgetreten. An einer ideologischen Distanzierung bestehen jedoch Zweifel (Forschungsnetzwerk 2019: 1).
[5] Siehe für die gleiche Stoßrichtung auch die Kommentare auf Feustel von Kühn/Lehn (2019) und Kumkar (2019).
[6] Verwiesen sei an dieser Stelle auf die zahlreichen Beiträge in den Ausgaben der Zeitschrift „Soziologie“ der Jahrgänge 2018 und 2019.
[7] An dieser Stelle sei noch einmal auf die lesenswerte Debatte in Teitelbaum (2019) hingewiesen, welche solche epistemologischen und moralischen Dilemmata innerhalb der anthropologischen Forschertradition verhandelt.
Literatur
Back, Les 2002: Guess Who’s Coming to Dinner? The Political Morality of Investigating Whiteness in the Gray Zone. In: Ware, Vron/Back, Les (Hg.): Out of Whiteness. Color, Politics, and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 33-59.
Bangstad, Sindre/Bertelsen, Bjorn Enge/Henkel, Heiko 2019: The Politics of Affect. Perspectives on the Rise of the Far-Right and Right-Wing Populism in the West. In: Focaal, Heft 83, 98-113.
Blee, Kathleen M. 2017: Understanding Racist Activism. Theory, Methods and Research. London/New York: Routledge.
Daphi, Priska/Kocyba, Piotr/Neuber, Michael/Roose, Jochen/Rucht, Dieter/Scholl, Franziska/Sommer, Moritz/Stuppert, Wolfgang/Zajak, Sabrina 2015: Protestforschung am Limit. Eine soziologische Annäherung an PEGIDA. ipb working paper. https://protestinstitut.eu/wp-content/uploads/2015/03/protestforschung-am-limit_ipb-working-paper_web.pdf [28.05.2019].
Diefenbach, Aletta 2019: Hassen im Modus bürgerlicher Etikette? Wie Neurechte über den Islam reden. In: Brokoff, Jürgen/Walter-Jochum, Robert (Hg.): Hass/Literatur. Literatur- und kulturwissenschaftliche Beiträge zu einer Theorie- und Diskursgeschichte. Bielefeld: transcript, 167-188.
Feustel, Robert 2019: Substanz und Supplement. Mit Rechten reden, zu Rechten forschen? Eine Einladung zum Widerspruch. sub\urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung, Jg. 7, Heft 1-2, 137-145.
Forschungsnetzwerkes Frauen und Rechtsextremismus 2019: Warum Liebe kein Zufall ist und Rechtsextremismusforschung einer professionellen Distanz zu ihrem Gegenstand bedarf. http://frauen-und-rechtsextremismus.de/2019/01/31/warum-liebe-kein-zufall-ist-und-rechtsextremismusforschung-einer-professionellen-distanz-zu-ihrem-gegenstand-bedarf/ [21.05.2019].
Freikamp, Ulrike 2008: Bewertungskriterien für eine qualitative und kritisch emanzipatorische Sozialforschung. In: Freikamp, Ulrike/Leanza, Matthias/Mende, Janne/Müller, Stefan/Ullrich, Peter/Voß, Hans-Jürgen (Hg.): Kritik mit Methode. Forschungsmethoden und Gesellschaftskritik. Berlin: Dietz-Verlag, 215-232.
Geiges, Lars/Marg, Stine/Walter, Franz 2015: PEGIDA. Die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft. Bielefeld: transcript.
Hametner, Katharina 2013: Wie kritisch ist die rekonstruktive Sozialforschung? Zum Umgang mit Machtverhältnissen und Subjektpositionen in der dokumentarischen Methode. In: Langer, Phil/Kühner, Angela/Schweder, Panja (Hg.): Reflexive Wissensproduktion. Anregungen zu einem kritischen Methodenverständnis in qualitativer Forschung. Wiesbaden: Springer VS, 135-146.
Hochschild, Arlie 2016: Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right. New York: New Press.
Kimmel, Michael 2013: Angry White Men. American Masculinity at the end of an Era. New York: Nation Books (Perseus Books Group).
Kocyba, Piotr 2016a: Über die ‚Veredelung des empirisch vorfindbaren Rassismus‘. Anmerkungen zu aktuellen Dresdner Studien über ‚Pegida‘. In: Klose, Joachim/Schmitz, Walter (Hg.): Freiheit, Angst und Provokation. Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der postdiktatorischen Gesellschaft. Dresden: Thelem, 187-237.
Kocyba, Piotr 2016b: Wieso PEGIDA keine Bewegung harmloser, besorgter Bürger ist. In: Rehberg, Karl-Siegbert/Kunz, Franziska/Schlinzig, Tino (Hg.): PEGIDA – Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und ‚Wende‘-Enttäuschung? Analysen im Überblick. Bielefeld: transcript, 147-163.
Krueger, Antje 2008: Die ethnopsychoanalytische Deutungswerkstatt. In: Freikamp, Ulrike/Leanza, Matthias/Mende, Janne/Müller, Stefan/Ullrich, Peter/Voß, Hans-Jürgen (Hg.): Kritik mit Methode. Forschungsmethoden und Gesellschaftskritik. Berlin: Dietz, 127-146.
Kühn, Annekatrin/Lehn, Katrin 2019: Let´s talk about …? Warum und wie wir mit Rechten reden müssen! Kommentar zu Robert Feustels „Substanz und Supplement. Mit Rechten reden, zu Rechten forschen?“. sub\urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung, Jg. 7, Heft 1/2, 159-166.
Kumkar, Nils 2019: Die Faktizität des Postfaktischen. Kommentar zu Robert Feustels „Substanz und Supplement. Mit Rechten reden, zu Rechten forschen?“. sub\urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung, Jg. 7, Heft 1/2, 167-172.
Leggewie, Claus 1987: Der Geist steht rechts. Ausflüge in die Denkfabrik der Wende. Berlin: Rotbuch Verlag.
Pasieka, Agnieszka 2019: Anthropology of the far right. Anthropology Today, Jg. 35, Heft 1, 3-6.
Patzelt, Werner 2016: Wer sind und wie denken Pegidianer. In: Patzelt, Werner/Klose, Joachim (Hg.): PEGIDA. Warnsignale aus Dresden. Dresden: Thelem, 149-294.
Pilkington, Hilary 2016: Loud and Proud: Passions and Politics in the English Defense League. Manchester: Manchester University Press.
Roer-Strier, Dorit/Sands, Roberta G. 2015: Moving beyond the ‘official story’. When ‘others’ meet in a qualitative interview. In: Qualitative Research, Jg. 15, Heft 2, 251–268.
Roth, Roland/Rucht, Dieter (Hg.) 2008: Die Sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch. Frankfurt am Main: Campus.
Shoshan, Nitzan 2016: The Management of Hate. Nation, Affect, and the Governance of Right-Wing Extremism in Germany. Princeton: Princeton University Press.
Slaby, Jan 2018: Drei Haltungen der Affect Studies. In: Pfaller, Larissa/Wiesse, Basil (Hg.): Stimmungen und Atmosphären. Zur Affektivität des Sozialen. Wiesbaden: Springer VS, 53-79.
Teitelbaum, Benjamin R. 2017: Lions of the North: Sounds of the New Nordic Radical Nationalism. Oxford: Oxford Univerity Press.
Teitelbaum, Benjamin R. 2019: Collaborating with the Radical Right. Scholar-Informant Solidarity and the Casae for an Immoral Anthropology. In: Current Anthropology, Jg. 60, Heft 3, 414-435.
Teune, Simon/Ullrich, Peter 2018. Protestforschung mit politischem Auftrag? Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 31, Heft 1–2, 418–425.
Zajak, Sabrina 2018: Engagiert, politisch, präfigurativ – Das Selbstexperiment als transformative Bewegungsforschung. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Jg. 31, Heft 4, 98-105.
Foto: Kalispera Dell – https://www.panoramio.com/photo/116227104, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38068798