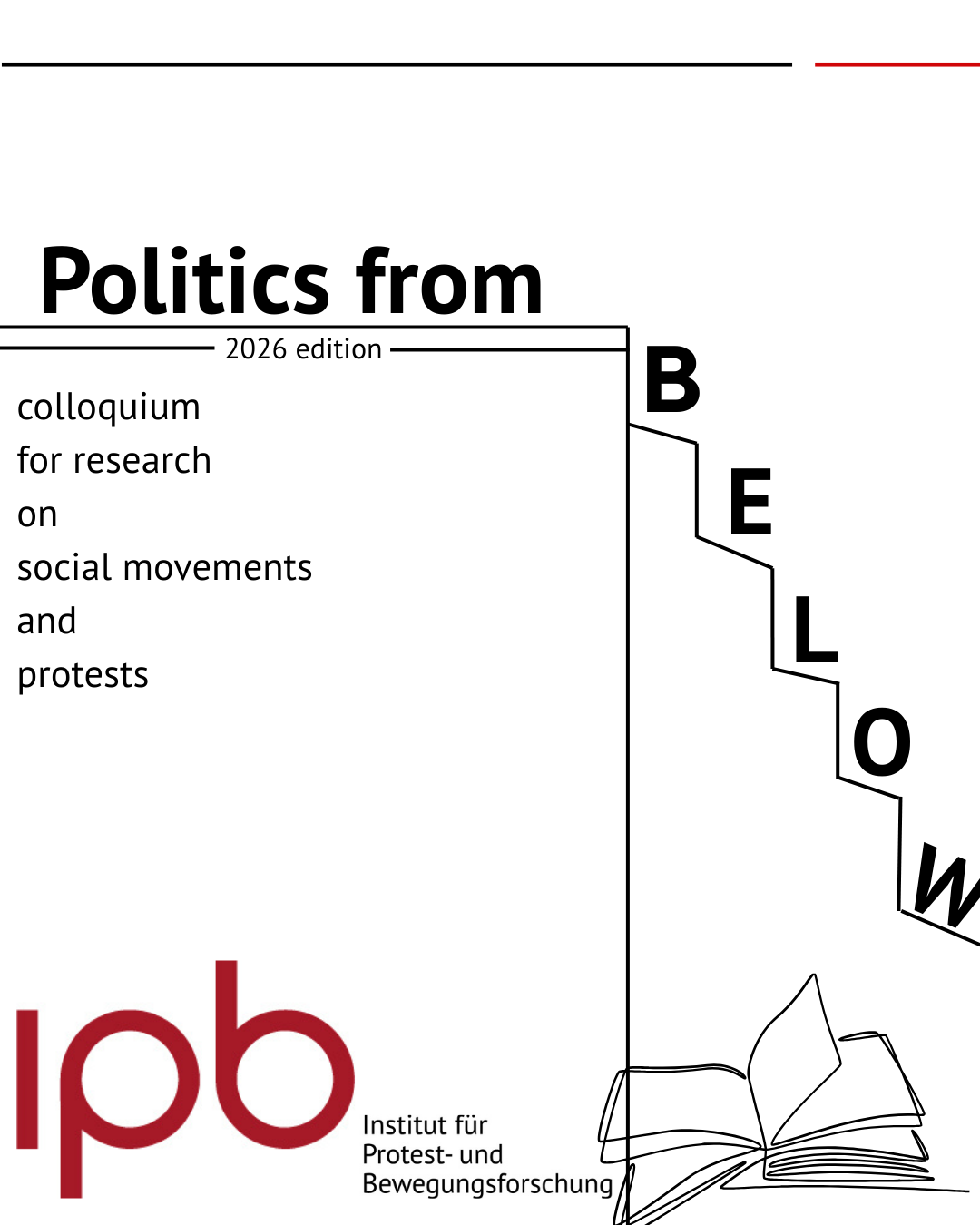Mitte Juni 2019 lud die Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) zur Fachtagung „Auf die Straße! Politischer Protest in Deutschland“ (Bericht des Deutschlandfunks). In drei Plenarvorträgen und 27 (!) Panels und Diskussionsrunden wurde das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven erörtert (Programm). Natürlich waren auch etliche ipb-Kolleg*innen vertreten, namentlich: Dieter Rucht, Ansgar Klein, Sebastian Haunss, Peter Ullrich, Simon Teune, Julia Zilles, Dieter Rink, Sabrina Zajak, Nina-Kathrin Wienkoop, Clemens Arzt, Lisa Vollmer, Verena Stern, Lisa Bogerts, Nils Schuhmacher und Elias Steinhilper.
Der folgende Tagungsbericht von Moritz Sommer ist als kollektiver Bericht zahlreicher ipb-Kolleg*innen entstanden. Auf Grund der Parallelität der Diskussionsrunden, kann im Folgenden nur ein Ausschnitt vorgestellt werden. Der Text erschien in ähnlicher Form auch auf der Webseite der bpb.
Der Vortrag von Dieter Rucht ist bei Deutschlandfunk Nova als Podcast verfügbar.
Auf die Straße! – Tagungsbericht
In Deutschland wird protestiert. Gegen Stuttgart 21, gegen den G20-Gipfel oder gegen die Unterbringung von Geflüchteten. Für den Erhalt des Hambacher Forstes, bezahlbaren Wohnraum oder die Einhaltung der Klimaverträge. Protest findet auf der Straße statt – in Großstädten und im ländlichen Raum. Er drückt sich in Transparenten, Sprechchören oder Unterschriftenlisten aus. Das Internet und die Sozialen Medien haben Möglichkeiten und Formen des Protestes erweitert. Protest ermöglicht direkte politische Beteiligung, jenseits von Wahlen und institutionalisierter Mitbestimmung. Für die einen ist Protest daher gelebte Demokratie, andere betonen den destruktiven Charakter von Protest als Hindernis effektiver Governance. Gerade weil Protest allgegenwärtig und umstritten ist, bleibt eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Gegenstand notwendig: Was ist Protest? Wie funktioniert er? Und wann ist er erfolgreich? Diese und andere Fragen standen im Zentrum der von der Bundeszentrale für Politische Bildung (BpB) organisierten Fachtagung „Auf die Straße! Politischer Protest in Deutschland“ am 17. und 18. Juni 2019. In Hamburg fand sich eine bunte Mischung aus erfahrenen und jungen (Bewegungs-)Forscher*innen, Journalist*innen, Veteran*innen der deutschen Protestgeschichte und Repräsentant*innen noch junger Protestbewegungen zur Diskussion zusammen. Dass es sich hier um eine der größten Fachtagungen im deutsch-sprachigen Raum gehandelt haben dürfte, kann als Beleg für die zunehmende öffentliche Beachtung von Protest betrachtet werden.
Einführung und historische Linien
„Protest!“ Unter diesem Titel gab Dieter Rucht (Institut für Protest- und Bewegungsforschung, ipb) den Startschuss. Gleich zu Beginn stellte er der verbreiteten Wahrnehmung von Protest als destruktiver Form der Ablehnung, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes und damit eine alternative, positive Sichtweise entgegen: Das deutsche Verb protestieren leitet sich ab vom spätlateinischen protestare, das so viel heißt wie ‚für etwas Zeugnis ablegen‘ oder ‚für etwas eintreten‘. Rucht definierte Protest in seiner heutigen Bedeutung als „eine kollektive, öffentliche Handlung nicht-staatlicher Akteure, die Kritik oder Widerspruch zum Ausdruck bringt und mit der Formulierung eines gesellschaftlichen oder politischen Anspruchs oder Ziels verbunden ist”.

In der historischen Betrachtung von Protest hätten diese kollektiven Handlungen ganz unterschiedliche Formen angenommen: von den Sklavenaufständen der Antike über die Bauernrebellionen der frühen Neuzeit bis hin zu den dann von sozialen Bewegungen getragenen bürgerlichen Revolutionen und den Arbeiter*innen-Protesten des 18. Jahrhunderts. Auch die wesentlichen Träger*innen und damit die Protestthemen hätten sich immer wieder verändert: von den klassischen ‚Brot und Butter‘-Fragen des frühen Kaiserreichs, über die ideologischen Grundsatzkonflikte der Weimarer Republik bis hin zu post-materialistischen Fragen mit dem Aufkommen der Neuen Sozialen Bewegungen. Das auch in Deutschland vielfach geäußerte diffuse Gefühl einer Zunahme von Protesten konnte Rucht unter Rückgriff auf empirische Daten zweier Protestereignisanalysen teilweise bestätigen. In der Bundesrepublik nehme demnach die Zahl der Proteste bei kurzfristigen Schwankungen bis in die späten 1990er Jahre zu, gehe dann zurück und steige seit 2005 wieder an. Auch diese Entwicklung sei ein Beleg für eine generelle ‚Normalisierung‘ von Protest, der immer mehr als gängige – und eben nicht als irrationale – Form der Interessenvertretung verstanden werde.
Anstelle des im Programm vorgesehen Sven Reichhardt (Universität Konstanz), der leider kurzfristig erkrankt war, hielt Philipp Gassert (Universität Mannheim) den zweiten Plenarvortrag zum Thema „Schlaglichter der deutschen Protestgeschichte“. In einer historischen Perspektive zeichnete er Protest als Ergebnis langer Entwicklungen, die sowohl das Repertoire als auch die gesellschaftliche Einordnung und Bewertung von Protest prägen. Gassert identifizierte historische Schlüsselmomente, um die sich wandelnden Charakteristika und die öffentliche Wahrnehmung von Protest zu rekonstruieren: Protest sei seit den Studierenden-Mobilisierungen um 1968 verstärkt „expressiv“, mit der Friedensbewegung um 1983 gesellschaftlich „akzeptabel“ und mit den Wendeprotesten um 1989 schließlich „normalisiert“ worden. Eine historische Perspektive zeige zudem, dass Protest nicht primär Motor, sondern vielmehr Indikator gesellschaftlichen Wandels sei. Nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Bewegungsakteure im Publikum stieß besonders diese starke und zugleich kontroverse These eine produktive Debatte zur gesellschaftlichen Bedeutung Sozialer Bewegungen an, die auch später immer wieder aufgegriffen wurde.
Im Anschluss an die beiden Einführungsvorträge nahmen nicht weniger als 27 Infopanels und Diskussionsrunden, verteilt auf vier Zeitblöcke, am 17. und 18. Juni die von Rucht und Gassert skizzierten Linien auf und vertieften sie.
Plurale Gesellschaften sind geprägt von multiplen Konfliktlinien und zeichnen sich durch eine Vielfalt an Meinungen und Interessen aus. Doch nicht in allen Fällen führen diese zu Protest. Im Panel „Warum hier und nicht dort? Entstehungshintergründe von Protesten“ war es erneut Philipp Gassert, der die großen historischen Linien zog. Dabei betonte er die Bedeutung gesellschaftlicher Konflikte, die von sozialen Bewegungen benannt würden und so kollektive Lernprozesse und politische Reformen nach sich zögen. Ansgar Klein (Forschungsjournal Soziale Bewegungen) erläuterte überblickshaft die wichtigsten analytischen Instrumente der Erforschung sozialer Bewegungen und erfolgreicher Mobilisierung, vom Ressourcen-Mobilisierungs-Ansatz, der die Rolle von Geld, Engagement und öffentlicher Unterstützung beleuchtet, über die Frage der politischen oder diskursiven Gelegenheitsstrukturen, die Mobilisierungsfenster öffnen oder schließen können, den „Framing-Ansatz“, der die Resonanzfähigkeit der Problembeschreibung als zentralen Faktor erfolgreicher Mobilisierung versteht, bis hin zur Rolle kollektiver Identität. In der anschließenden Diskussion und der Anwendung auf jüngste Protestphänomene wurde deutlich, dass oft nur ein ganzes Bündel von sozialwissenschaftlichen Analyseansätzen die Mobilisierungserfolge einzelner Bewegungen erklären kann.
Welche Kriterien für „erfolgreichen“ Protest lassen sich auch jenseits der Frage der Mobilisierung anlegen? Das Panel „Das nützt doch nichts … Über Erfolge, Misserfolge und Erfolgsbedingungen“ versprach Antworten. Sebastian Haunss (ipb und Universität Bremen) schlug vor, mindestens drei Dimensionen von Erfolg zu unterscheiden: Erstens in der zeitlichen Dimension, ob es um kurzfristige oder langfristige Wirkungen sozialer Bewegungen geht. Zweitens sollte auf der Ebene der Reichweite zwischen Policy-Wandel und gesellschaftlichem Wandel unterschieden werden und drittens auf der Ebene der Handlungsmacht, zwischen eigenverantwortlichen sowie auf Unterstützung angewiesenen Erfolgen. Mit diesem Schema lässt sich der kurzfristige Erfolg eines lokalen Protestbündnisses von der langfristigen gesellschaftlichen Wirkung beispielsweise der Frauenbewegung systematisch unterscheiden. Für Gerald Neubauer (Campact) ist gesellschaftlicher Fortschritt, wie die (rechtliche) Gleichberechtigung von Mann und Frau ohne die Kraft sozialer Bewegungen kaum denkbar. Indem sie als selbstverständlich erachtete Sozialstrukturen hinterfragten, seien soziale Bewegungen eine zentrale Triebfeder gesellschaftlichen Fortschritts. Eine zentrale Erfolgsbedingung sei die Bereitschaft der Aktiven, sich über ungerechte Gesetze hinwegzusetzen und diese zu delegitimieren. So habe ziviler Ungehorsam immer wieder zu Gesetzesänderungen und Reformen geführt, wie z.B. das Ende der Rassentrennung in den USA eindrücklich zeige. Bemerkenswert ist, dass Misserfolge sowohl von den Vortragenden als auch in der Diskussion nur ganz am Rande thematisiert wurden: eine Leerstelle, die sich auch in der Protestforschung allgemein zeigt.
Mediale Wahrnehmung – mediale Inszenierung
Die Frage nach den Erfolgsbedingungen von Protest lenkt den Blick auf die Rolle der Medien und die öffentliche Wahrnehmung von Protest. Die Podiumsdiskussion „Ein Wechselspiel – Medien und Protest“ mit Marcus Bornheim (stellvertretender Chefredakteur der Tagesschau), Michael Hopf (Greenpeace) und Simon Teune (ipb und TU Berlin) nahm als Ausgangspunkt, dass die meisten Menschen erst über Beiträge im Radio, im Fernsehen, in Tageszeitungen und deren Online-Plattformen Proteste wahrnehmen. Dadurch entscheiden journalistische Kriterien darüber, welcher Protest sichtbar wird und welche Aspekte hervorgehoben werden. Nur eine einstellige Prozentzahl der Proteste findet so den Weg in die Berichterstattung. Bornheim unterstrich, dass Proteste in der Konkurrenz um den begrenzten medialen Raum nur dann berücksichtigt würden, wenn sie mit Nachrichtenwerten wie Größe, Konfliktpotenzial oder Neuheit versehen seien. Inwiefern die Kriterien von Journalist*innen auch die Arbeit der Protestakteure beeinflussen, zeigt das Beispiel Greenpeace: Einzelne Aktionen der Umweltorganisation werden so geplant, dass sie durch spektakuläre Bilder die journalistische Nachfrage nach Konflikt bedienen. Michael Hopf betonte dabei allerdings, dass die Themenauswahl von Greenpeace sich nicht primär an der Verwertbarkeit in den Medien orientiere. Viele Formen der Kommunikation liefen an den Medien vorbei, z. B. in der direkten Kommunikation mit Mitgliedern und Ortsgruppen. Die Bilder seien vor allem eine Möglichkeit, alternatives Wissen in breitere Diskurse einzuspeisen. Die Moderatorin Nalan Sipar (Deutsche Welle) führte die Diskussion immer wieder auf konkrete Ereignisse zurück. So wurde der Erfolg der Klimastreiks der FridaysForFuture unter anderem damit erklärt, dass die Identifikationsfigur Greta Thunberg, gepaart mit der gewählten Aktionsform, eine gut zu erzählende Geschichte geboten hätte, die das Thema Klimawandel auch auf die Agenda der Redaktionen gesetzt hätte.
Die Abhängigkeit von der medialen Berichterstattung beeinflusst wiederum Protestakteure in der Wahl ihrer Mittel. Simon Teune verwies im thematisch anschließenden Panel „Plakate, Transparente, Trillerpfeifen. Inszenierungsformen von Protest“ darauf, dass Protestformen nicht völlig frei gewählt würden, sondern im Verhältnis zu verschiedenen Akteuren zu verstehen seien. Die Reaktion von Regierenden, Medien und Polizei würden mit Vorgaben und Reaktionen auf Protest die Wahl von Protestformen mitprägen. In sozialen Bewegungen gäbe es parallele Aktionsrepertoires, bei denen die verschiedenen Protestmilieus unterschiedliche Grenzen setzten und über Bilder und Sprache Korridore des erwünschten Protestes definierten. Lisa Bogerts (ipb) betonte, dass sich die Inszenierung von Protest – als öffentliche Bühne der Selbstdarstellung nach außen –sowohl von der Kommunikation von Bewegungen nach innen als auch von der (Fremd-) Darstellung durch andere, wie z. B. Medien und Politiker*innen, unterscheiden könne. Um ihre Ziele zu kommunizieren, Aufmerksamkeit zu erregen und (potenzielle) Anhänger*innen zu mobilisieren, würden Protestierende ihre Identifikationsangebote nicht nur mithilfe von rationalen Argumenten unterbreiten, sondern auch durch emotionale und soziale Anknüpfungspunkte. Oft müssten dafür komplexe politische Sachverhalte und Ideologien in einfache und schnell verständliche Botschaften sowie ästhetisch-visuelle Zeichen mit hohem Wiedererkennungswert heruntergebrochen werden, was im wahrsten Sinne des Wortes zu plakativen und oft verkürzten Botschaften sowie Freund/Feind- oder Täter/Opfer-Schemata führen könne. Während Proteste visuell durch Farben und Flaggen, (Un-)Gerechtigkeitssymbole, personifizierende Protest-Ikonen sowie empörende oder humorvolle Bilder inszeniert würden, gälte vor allem das Zitat eines Anonymous-Aktivisten: „Langeweile ist konterrevolutionär“.
Bereits vor dem skizzierten Panel lieferte Dorna Safaian (Universität Siegen) in ihrem Vortrag „Ästhetik des Protests“ mit dem Rosa Winkel – dem Symbol der Schwulenbewegung der 1970er Jahre – ein eindrückliches Beispiel für die verschiedenen Dimensionen des sinnlich wahrnehmbaren Protestes. Symbole wie der ursprünglich in KZ als Kennzeichnung homosexueller Häftlinge verwendete und von der Homosexuellen Aktion Westberlin als Erkennungszeichen eingeführte Rosa Winkel werden im Handeln der Protestierenden mit Bedeutung und Emotionen aufgeladen. Sie haben die Funktion, Konfliktlinien sowohl nach außen als auch bewegungsintern zu markieren. So wurde der Rosa Winkel eingeführt, um gegenüber anderen Protestbewegungen eine eigene Bildsprache zu entwickeln und für die Gruppe der Schwulen über die erlittene Repression eine kollektive Identität zu stärken. Relevant werden Protestmedien im Gebrauch, sei es bei Protestereignissen oder im Alltag. Der Rosa Winkel wurde in der Öffentlichkeit als Kennzeichen der Schwulen präsentiert – auf Plakaten und mit Ansteckern getragen. Das Zeigen des Symbols wurde aber auch als eine symbolische Handlung zur Überwindung der eigenen Angst verstanden. Insofern sind Protestmedien immer auch mit kollektiven emotionalen Praktiken, also in Gemeinschaft entstehenden und empfundenen Gefühlen, verbunden.

Die Frage nach dem Wandel von Protestästhetik, aber auch die nach der Resonanz und Wirkmächtigkeit von Protest stellen sich in Zeiten von Facebook, Twitter und Co auf besonders eindrückliche Weise. Lisa Villioth und Gina Schad (beide Universität Siegen) gingen im Panel „‘1 like = geht gar nicht‘. Der Wandel von Protest im digitalen Zeitalter“ dem Zusammenhang zwischen Straßen- und Netzprotesten nach. Villioth konzentrierte sich zu Beginn auf die Rolle von E-Campaigning-Plattformen wie Campact oder change.org, die das Mittel der Petition auf das Internet übertragen. Demonstrationen oder Sit-ins als klassische Aktionsformen werden durch diese Plattformen nicht etwa abgelöst, sondern ergänzt, indem sie niedrigschwellige Mittel für die Mobilisierung im Vorfeld, die interaktive Begleitung sowie die Nachbereitung von Protestereignissen bieten. Mit dem Netz als Protestmedium vergrößert sich damit das Potenzial sozialer Bewegungen, ihren Anliegen in Politik und Gesellschaft Gehör zu verschaffen. Gina Schad erweiterte die Perspektive auf den Netzprotest anhand des aktuellen Beispiels des YouTubers Rezo. Die kontroverse Debatte um dessen CDU-kritisches Video belege die zeitliche wie räumliche Entgrenzung digitaler Kommunikation. Aus dem digitalen Wandel folgen neben den Plattformen als Bewegungsakteure auch neue Anforderungen für die Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs. Für die Vortragenden gelten Kommunikationspraktiken wie Likes oder Retweets und daran anknüpfende Empörungsdynamiken als Ausgangspunkt digitalen Protests. Um tatsächlich kollektive, digitale Protestereignisse zu bilden, bedarf es allerdings eines höheren Organisationsgrads und öffentlicher Resonanz.
Diese digitalen Protestformen sind nicht allein der Jugend vorenthalten – dennoch spiegelt sich hier die Kommunikationskultur einer neuen netzaffinen Generation wider. Vor diesem Hintergrund und spätestens seit den Protesten von FridaysForFuture ist die Rede vom Generationen- oder Jugendprotest wieder auf der Agenda. Knud Andresen (Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg) und Gabriele Rohmann (Archiv der Jugendkulturen e.V., Berlin) wagten eine historische Perspektive und widmeten sich im Panel „Rebel without a cause? Jugend zwischen Protest und Anpassung“ früheren Jugendprotesten in Ost- und Westdeutschland. In beiden Vorträgen wurde die Bedeutung kultureller Symboliken und Praktiken der Jugend als Widerstandsformen gegen die jeweilige Mehrheitsgesellschaft und das politische System deutlich. Konkret für Westdeutschland illustrierte Andresen, dass die Jugend von den 1950er bis in die 1980er Jahre die Avantgarde eines Wertewandels darstellte, die über bestimmte Tanz- und Musikformen gegen den soziopolitischen Mainstream rebellierte. Seit den 1980er Jahren jedoch zeigen Untersuchungen wie die Vermächtnisstudie von Jutta Allmendinger, dass man nicht mehr von einem Generationskonflikt sprechen könne, da Einstellungsdifferenzen nicht über Alter erklärt werden könnten. Das Label „Jugendproteste“ sei somit auch heute zumindest teilweise irreführend. Der zweite Impulsvortrag zeigte äquivalent hierzu die Entwicklungen von und den staatlichen Umgang mit Jugendkulturen in der DDR. Gabriele Rohmann illustrierte eindrücklich zahlreiche Ähnlichkeiten mit der Bundesrepublik, wenngleich die Bedingungen, unter denen sich die Jugend in Ostdeutschland ausleben konnte, divergierte. Die Reaktion der DDR-Regierung schwankte zwischen Restriktionen und Repressionen sowie dem Versuch der Vereinnahmung durch staatlich geschaffene Organisationen.
Wandel und Institutionalisierung
Proteste sind Agenten des Wandels, aber auch Protestakteur*innen selbst unterliegen stetigem Wandel. Auf eine ganz bestimmte Form des Wandels (und des Erfolgs?) konzentrierte sich das Panel „‘Rein in die Parlamente!‘ Aus Protest wird Partei“ anhand der Parteien Bündnis90/Die Grünen und Alternative für Deutschland (AfD). Andreas Pettenkofer (Universität Erfurt) begann seinen Vortrag zur Geschichte der Grünen mit Blick auf einen möglichen Vergleich zur AfD, indem er den Begriff der Protestpartei problematisierte. Die Abgrenzung zu vermeintlich ‚normalen‘ Parteien falle mit diesem Begriff schwer, weil er sich weder durch Wahlentscheidungen, das Hervorgehen aus sozialen Bewegungen noch aus einem positiven Bezug auf Protest eindeutig bestimmen ließe. Weiter plädierte Pettenkofer dafür, die These einer inhaltlichen Normalisierung der Grünen seit ihrem Einzug in den Bundestag zu verwerfen. Zu umstrittenen Themen wie dem radikalen Pazifismus, Kritik der Staatsgewalt und der Kapitalismuskritik habe es schon in der Frühgeschichte der Grünen immer wieder Ambivalenzen gegeben. Jenseits der Inhalte habe sich die Parlamentarisierung der Umweltbewegung stärker auf der organisationalen Ebene niedergeschlagen, und zwar durch Institutionalisierung und Hierarchisierung oder neue Kooperationen. Demgegenüber beschäftigte sich Alexander Hensel (Universität Göttingen) mit einer Einordnung der AfD als Protestpartei. Aus stärker politikwissenschaftlicher Perspektive beschreibe der Begriff für ihn eher das Aufstreben einer elitenkritischen Organisation als einer neuen Alternative im Parteiensystem. Der Wandel des Parteiensystems im postindustriellen Zeitalter erlaube es den neuen Akteuren, eine allgemeine Haltung der Politikverdrossenheit unter den Wähler*innen über ein Thema zu mobilisieren. Im Fall der AfD sei dies zuerst über ‚Wettbewerbspopulismus‘ gelungen, der in einer zweiten Entwicklungsphase vom klassischen Rechtspopulismus abgelöst worden sei. Der Protest gegen das Establishment habe sich somit auch auf die Straße verlagert und die Erfolge an der Wahlurne gestärkt. Mit dem Einzug in die Parlamente stünde die Partei laut Hensel allerdings vor einem Dilemma, weil einerseits eine anhaltende Protest-Haltung im institutionellen Kontext zu Isolation führe, während andererseits Anpassungsprozesse die Establishment-Kritik konterkarieren würden.
Eine strukturelle Form der Institutionalisierung wurde im Panel „Wendland, Kreuzberg, Dresden? Aus Protest wird Milieu“ diskutiert. Andreas Tietze (Aktion Zivilcourage e. V., Pirna) schilderte seine Erfahrungen aus der politischen Bildungsarbeit in Dresden sowie den sächsischen Umlandgemeinden und zeigte deutlich, wie sich dort in den letzten zehn Jahren eine rechte Szene herausgebildet hat, die von Personen zusammengehalten wird, welche maßgeblich in die Organisation der Pegida-Proteste involviert sind. Diese verfügten über eigene Treffpunkte, Buchläden und Publikationen. Das dort zu beobachtende soziale Phänomen erfülle genau die Kriterien, die Sebastian Haunss (ipb und Universität Bremen) zuvor als charakteristisch für bewegungsnahe Szenen identifiziert hat, die gleichzeitig Netzwerke von Personen, Gruppen und Orten sind und die es Bewegungsaktivist*innen erleichtern, eine gemeinsame Gruppenidentität herauszubilden und geteilte subkulturelle Praxen zu leben.
Die soziale Basis von Protest und die Frage, wer überhaupt protestiert, wurde im Panel „Typisch! Über die soziale Basis und Interessenlagen von Protest“ aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven thematisiert. Nina-Kathrin Wienkoop (ipb und Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung) zeigte auf, wie zunächst die Arbeitskämpfe und später die Neuen Sozialen Bewegungen die Bilder von Protestierenden aber auch die Forschung selbst prägten. Typische Beschreibungen von Protestierenden rangierten von „Arbeiter“ über „Studenten“ bis hin zu „Linksintellektuelle“. Aktuelle Protestsurveys hingegen zeigen eine große Bandbreite in Bezug auf sozio-strukturelle Merkmale wie Geschlecht, Alter oder Links-Rechts-Selbstzuschreibung. Gemein ist ihnen, dass mehrheitlich gut gebildete Personen der Mittelschicht protestieren sowie Menschen ohne Migrationshintergrund. Nur selten treten die am meisten Benachteiligten als Träger von Protest auf. Diese Muster zeigten sich auch am Beispiel der Proteste gegen Windkraftenergie, die Eva Eichenauer (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung e.V.) im Anschluss vorstellte. An zwei Beispielen in Süd- und Ostdeutschland machte sie deutlich, wie unterschiedlich Konfliktaushandlungen geprägt sind. Obwohl sich die Initiator*innen bezüglich Alter und Schichthintergrund ähnelten, traten die Wortführer*innen sehr unterschiedlich auf. So waren die Zusammenkünfte von Windkraft-Befürworter*innen mit den Gegner*innen in Brandenburg von einer hohen Dialogbereitschaft geprägt, wohingegen im Schwarzwald die Protestierenden konfliktiver auftraten.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 68er-Bewegung werden Straßenproteste oft noch immer als Sache der Linken wahrgenommen. Dass dieser Eindruck täuscht, zeigen eindrücklich das Beispiel Pegida und die Neusortierung der deutschen Protestlandschaft im Anschluss an den Anstieg von Asylsuchenden im Herbst 2015. Das Panel „Die sollen weg hier!“ Proteste gegen „Fremde“ beleuchtete Proteste gegen Personen, die als „fremd“ wahrgenommen und konstruiert werden, darunter Migrant*innen und Geflüchtete. Stefan Locke (Frankfurter Allgemeine Zeitung für Sachsen und Thüringen) skizzierte in seinem Beitrag die Anfänge und den Verlauf der Pegida-Proteste in Dresden. Diese kontextualisierte er in einem historischen Rückblick auf den gesellschaftlichen Umgang mit Vertragsarbeiter*innen aus Mosambik, Polen und Vietnam, zu denen es aus der Bevölkerung kaum Kontakt oder Integrationsbemühungen gab. Den Zulauf zu den Protesten von Pegida interpretierte Locke als Gelegenheit, sich und seinen Anliegen Gehör zu verschaffen, auch wenn diese nicht immer unmittelbar mit Migration verknüpft gewesen seien. So sei beispielsweise die Ost-West-Frage im Zuge der Proteste erneut verhandelt worden. Verena Stern (ipb und Universität Bielefeld) leistete im zweiten Teil des Panels einen Überblick über Proteste gegen Geflüchtete und ihre (geplanten) Unterkünfte. Sie verglich den signifikanten Anstieg der Proteste im Kontext des „langen Sommers der Migration“ 2015 mit dem Beginn der 1990er Jahre, als ebenfalls eine große Anzahl an Übergriffen auf Migrant*innen und ihre Unterkünfte verübt wurde. Stern wies dabei auf Ähnlichkeiten im medialen und politischen Diskurs über Migration hin: Wie in den 1990er Jahren könne das Phänomen nicht auf den „Osten“ reduziert werden, sondern finde sich auch in den alten Bundesländern wieder. Zudem blende der Fokus auf extrem rechte Protest-Akteur*innen die vielfältigen Zusammenschlüsse zwischen Rechtsextremen und Bürger*innen aus der sogenannten Mitte weitgehend aus.
In der Polarisierung zwischen Migrationsgegner*innen und Befürworter*innen aus der so genannten Mehrheitsgesellschaft geht die Mobilisierung der tatsächlich Betroffenen oftmals unter. Das Panel „‘Kein 10. Opfer!‘ Proteste von Geflüchteten, Migranten und Neuen Deutschen“ lenkte den Blick auf Formen (prekären) Protests im Einwanderungsland Deutschland. Elias Steinhilper (ipb und Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung) plädierte zunächst dafür, die Großkategorie „migrantischer Protest“ zu entpacken und nahm anschließend eine konzeptionelle und empirische Verortung des Gegenstands vor. Er zeigte die theoretischen und praktischen Herausforderungen in der Mobilisierung von Nicht-Bürger*innen auf, die oftmals ganz fundamental um das Arendt‘sche „Recht, Rechte zu haben“ ringen müssten und zusätzlich mit einem erschwertem Zugang zu Ressourcen, stigmatisierenden Diskursen und fragmentierten (nationalen und ethnischen) Identitäten konfrontiert seien. Vor diesem Hintergrund zeigte er auf, dass Menschen mit Migrationsgeschichte trotz aller realen Herausforderungen Protest organisieren und sich ein Repertoire migrantischen Protests herausgebildet hat. Hier knüpfte Ilker Ataç (Hochschule RheinMain) an und führte am Beispiel der Proteste von Asylsuchenden aus, welche relationalen und expressiven Effekte Hungerstreiks, Märsche und autonome Protestcamps zeitigen. Durch die Bewegung aus der Isolation vieler Sammelunterkünfte in zentrale Lagen würden protestierende Asylsuchende nicht nur einen expressiven Akt der Selbstermächtigung und des Sichtbarwerdens vollziehen, sondern gleichzeitig Zugang zu Ressourcen und Netzwerken realisieren, die für eine längerfristige Mobilisierung unabdingbar seien. In der anschließenden lebhaften Diskussion weitete sich der Blick in Richtung „post-migrantischer“ Allianzen, d. h. auf die Frage, in welchem Verhältnis migrantische und nicht-migrantische Mobilisierungen im kollektiven Ringen um Teilhabe in pluralen Gesellschaften stehen.
Gleich mehrere Panels der Tagung widmeten sich der Rolle der Polizei und dem polizeilichen Umgang mit Protest. Immer wieder trafen dabei konträre Sichtweisen aufeinander, nicht zuletzt von Polizist*innen auf der einen Seite und den Akteur*innen von Protest, die zahlreich vertreten waren, auf der anderen – alle geprägt auch von persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen. Mehr oder weniger dazwischen befanden sich die Expert*innen aus der Protest- und Polizeiforschung, die teilweise kritische Blicke auf aktuelle Entwicklungen warfen und die Versammlungsfreiheit unter dem Druck autoritärer Entwicklungen bedroht sehen. Der Berliner TU- und ipb-Forscher Peter Ullrich demonstrierte am Fall Hamburg, dass unerklärte Ausnahmezustände wie bei den G20-Protesten 2017 trotz lokaler Sonderbedingungen auch als Zukunftsszenario andernorts drohen könnten. Andere, darunter Hartmut Aden (Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin), mahnten zumindest Verbesserungen an – sowohl im teils nicht mehr zeitgemäßen Versammlungsrecht als auch in manchen grundrechtlich problematischen Praxen der Polizei. Denn, so Aden, beide orientierten sich an überkommenen Vorstellungen zentral organisierter Märsche, die wenig mit der Form des aktuellen, vielfältigen Protestgeschehens zu tun hätten.
Einen ähnlichen Grundton verband die Diskussionen mit Christoph Kopke (Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin) und Kai Seidenstricker (Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle des LKA NRW) zu Feindbildern zwischen Polizist*innen und Demonstrierenden sowie im Panel „Wieso Weshalb Warum? Eskalationen bei Protesten“: Immer wieder ging es um Möglichkeiten der Deeskalation und Konfliktminimierung, also auch um die Suche nach diesem oder jenem Fehlgriff und wie dieser in Zukunft zu vermeiden sei. Verbreitet war in dieser (optimistischen) und dialogischen Perspektive die Idee, durch bessere Kommunikation, gemeinsame Workshops oder politische Bildung eine Verbesserung des Verhältnisses Demonstrierende/Polizei zu erzielen. Einige Diskutierende kritisierten diesen Zugang zum Thema, da es eine „Kuschelrock-Atmosphäre“ verbreite und so tatsächliche Antagonismen und strukturelle Ungleichheiten zwischen beiden Akteuren verschwänden.
Fragen von Eskalation und Deeskalation waren auch für Nils Schuhmacher (Universität Hamburg) und Rafal Behr (Akademie der Polizei Hamburg) im Panel „Gipfelprotest. Der G20 in Hamburg“ zentral. Schuhmacher konstatierte einen Fehlschluss der Kausalität, der die Komplexität der Eskalationsprozesse in Hamburg auf vermeintlich taktische Planungen radikaler Protestierender reduziere. Vielmehr sei die Eskalation in Hamburg als ein Ausdruck von kollektivem Kontrollverlust und als ein eben nicht zwangsläufiges Resultat von situativen Interaktionsdyamiken zwischen Polizei und Protestierenden zu verstehen. Ein zentrales Problem sei dabei die Vereinheitlichung des jeweiligen Gegenübers, die die tatsächliche Heterogenität des Protestspektrums in Hamburg negiert habe. Immer wieder existierende Möglichkeiten der Deeskalation wurden auch aus diesem Grund verpasst.
In den lebhaften Diskussionen wurden die verschiedenen Perspektiven und Erkenntnisse immer wieder für die Interpretation aktueller Protestbewegungen herangezogen. Dabei ist kaum eine Bewegung derzeit präsenter als FridaysForFuture. Sei es zur Frage erfolgreichen Framings, zu der nach der sozio-strukturellen Basis der Proteste, der Frage von Erfolg und Misserfolg oder der nach der Vergleichbarkeit mit ihren historischen Vorläufern – immer wieder kamen die Diskussionen auf diesen neuen Akteur der Klimabewegung zurück.
So war es nur folgerichtig, dass die Tagung mit einem Blick auf Schüler*innenproteste, insbesondere die FridaysForFuture-Proteste, und damit die unmittelbare Gegenwart und Zukunft von Protest in Deutschland endete. Die stellvertretende hessische Landeschulsprecherin, Lou-Marleen Apphuhn relativierte die zuvor allgemein attestierte These einer zunehmenden Akzeptanz von Protest am Beispiel der jüngsten Klimaproteste der Schüler*innen. Vielmehr zeigten herablassende Reaktionen der Politik und die Debatte um das Schulschwänzen, dass ihr Protest noch immer nicht als ernstzunehmende Form der politischen Intervention anerkannt würde. Die weitere Diskussion mit den FridaysForFuture-Aktivist*innen offenbarte indes ein hohes Maß an Professionalität, Motivation und strategischer Weitsicht der Bewegung, sodass auch den eher skeptischen Betrachter*innen zum Ende klar wurde: Mit kraftvollen Protesten der Jugend ist auch in Zukunft zu rechnen.
Foto: BrThomas, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21189318